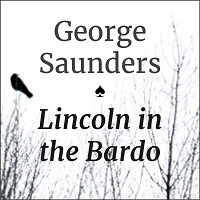 Während im Februar 1862 im Zuge des gerade wütenden Sezessionskriegs auf den Kriegsschauplätzen unzählige Soldaten sterben, stirbt in Washington Abraham Lincolns 11-jähriger Sohn Willie an einer Typhus-Erkrankung. Der von Trauer gezeichnete Präsident kehrt nach der Beerdigung mehrfach zum Grab des Sohnes zurück. Zeitgenössische Zeitungen berichten, dass er den Leichnam seines Sohnes aus dem Sarg nahm, trauernd, niedergeschmettert, verzweifelt. Hieraus entspinnt sich nun George Saunders Idee zu „Lincoln in the Bardo“, wo der Autor den gerade verstorbenen Willie und seinen Vater auf dem Friedhof aufeinandertreffen lässt.
Während im Februar 1862 im Zuge des gerade wütenden Sezessionskriegs auf den Kriegsschauplätzen unzählige Soldaten sterben, stirbt in Washington Abraham Lincolns 11-jähriger Sohn Willie an einer Typhus-Erkrankung. Der von Trauer gezeichnete Präsident kehrt nach der Beerdigung mehrfach zum Grab des Sohnes zurück. Zeitgenössische Zeitungen berichten, dass er den Leichnam seines Sohnes aus dem Sarg nahm, trauernd, niedergeschmettert, verzweifelt. Hieraus entspinnt sich nun George Saunders Idee zu „Lincoln in the Bardo“, wo der Autor den gerade verstorbenen Willie und seinen Vater auf dem Friedhof aufeinandertreffen lässt.
Willie findet sich auf dem Friedhof inmitten einer illustren Gesellschaft von Friedhofsbewohnerinnen und -bewohnern wieder, die darauf warten, wieder gesund zu werden, um endlich in ihr früheres Leben zurückkehren zu können, wo sie noch wichtige Dinge zu erledigen haben, noch Wichtiges auszurichten haben an die, die dort auf sie warten. Wir sind im Bardo, nach buddhistischem Glauben dem Zwischenreich zwischen Dies- und Jenseits.
In einer Mischung aus Collage und Theaterstück erzählt Saunders in „Lincoln in the Bardo“ (2017 auf Englisch im Verlag Random House erschienen, 2018 bei Luchterhand als „Lincoln im Bardo“ auf Deutsch) vom Verlust des Sohnes und der familiären Tragödie der Lincolns auf der einen Seite und den Schwierigkeiten, vom früheren Leben loslassen zu können und der Angst vor dem unbekannten Danach auf der anderen.
Unterschiedlichste Charaktere bevölkern das Zwischenreich auf dem Friedhof, manche zu Grimassen, Fratzen, unförmigen Wesen verzerrt, manche durchaus zufrieden, manche halb vergessen vor sich hinvegetierend. Während sich die meisten nur um sich selbst kümmern, sorgen sich drei Bewohner des Friedhofs, Hans Vollman, Roger Bevins III und Reverend Everly Thomas, um Willie Lincoln, denn für ein Kind ist es mehr als ungewöhnlich, dass es im Bardo länger als nur wenige Minuten verbringt. Normalerweise verschwinden Kinder fast umgehend wieder aus dem Zwischenstadium. Willie aber sitzt oben auf seiner Gruft und wartet – darauf, dass sein Vater zurückkommt. Und während Vollman, Bevins und Thomas versuchen, ihm das Warten auszureden, geschieht das für sie völlig Unvorstellbare: Der Vater kommt zurück, geht in Willies Gruft und hebt dessen Leichnam aus dem Sarg.
Parallel zur Handlung auf dem Friedhof lesen wir Zeitungsausschnitte, Tagebuchnotizen, Briefauszüge, die sich mit dem Leben Abraham Lincolns und dem Verlust seines Sohnes beschäftigen, lesen Auszüge aus Hasspost, lesen mitfühlende Berichte, Vorwürfe, Häme. Die Stärke von „Lincoln in the Bardo“ liegt zweifelsohne in dieser Collage – in der Ansammlung verschiedenster Quellen, die sich schon über die kleinsten Fakten uneins sind, sei es die Augenfarbe Lincolns („dark grey“, „a luminous gray color“, „gray-brown eyes“, „His eyes were bluish-brown“, „bluish-gray“, „kind blue eyes“), sein Aussehen, seine Benehmen oder sein Charakter. Ein Spiel mit der Unsicherheit von Zuschreibungen, Augenzeugenberichten, historischen Quellen, mit der Geschichtsschreibung und ihrer Greifbarkeit. Auch diese Seite wirkt dadurch wie ein Gewirr verschiedenster Stimmen, die wie die Geister auf dem Friedhof durcheinanderreden und ihre völlig unterschiedlichen Interpretationen beisteuern. Schade ist allerdings, dass Saunders den Leser dabei im Unklaren lässt, ob es sich dabei um echte Quellen handelt oder um fiktive – nachgestellt ist ihnen immer ein Zitationsnachweis, der in vielen Fällen auch zu echten Quellen führt, der teils aber auch erfunden ist. Das nimmt der Collage ein wenig die Wucht, zumal man, will man mit dem Lesen kein Quellenstudium verbinden, schlichtweg nicht weiß, ob das jeweilige Zitat nun echt oder ausgedacht ist.
Auch das Verhältnis zwischen Ernst und Humor wirkt teils nicht ganz austariert. Geradezu pubertäre Szenen gehen einher mit vielen tragischen Figuren, die verletzt und geschunden über den Friedhof irren, die in nur wenigen Sätzen ganze Abgründe aufreißen – seien es Mordopfer, Vergewaltigungsopfer oder andere Seelen. Auf der Suche nach Hilfe, Erlösung oder einem Ausweg sind sie teils kaum verständlich, sprechen oftmals in Sätzen, die im Nichts enden. Auch ihre äußere Erscheinungsform ist manchmal auch für die anderen kaum noch erkennbar, wie bei Mr. Papers, der kaum mehr als ein Strich ist und hilfesuchend umherirrt („Cannery anyhelpmate? Come. To. Heap me? Cannery help?“). Daneben wirkt so manch eine Stelle mit „Untenrum-Witzchen“ seltsam unpassend.
Dennoch ist „Lincoln in the Bardo“ eine kurzweilige, tragikomische Lektüre. Es wäre nur schöner gewesen, wenn nachvollziehbar gewesen wäre, ob beispielsweise der herzzerreißende, Schreibfehlern nur so strotzende Brief eines Vaters, der gerade seinen Sohn im Bürgerkrieg verloren hat und nun vorwurfsvoll an Lincoln schreibt, echt ist. Dann wären solche Stellen vielleicht von vornherein nicht mit Enttäuschung verbunden, wenn man nach entsprechender Recherche herausfindet, dass sie zu den fiktionalen „Quellen“ gehören.
♠ George Saunders: Lincoln in the Bardo. Deutsche Taschenbuchausgabe: Lincoln im Bardo. btb Verlag 2019, 448 Seiten, 12,- Euro. ISBN: 978-3442718979. ♠

