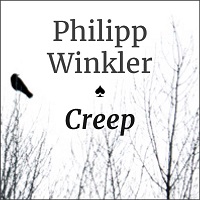 Welche Auswirkungen kann es haben, wenn man von klein auf ungefiltert mit allen Abgründen, die das Internet zu bieten hat, konfrontiert wird? Wie sehr kann die Seele verrohen oder abstumpfen, wenn Videos von Enthauptungen oder von gequälten Katzenbabys so normal sind wie Werbespots? Philipp Winklers neuer Roman „Creep“ porträtiert zwei junge Menschen, bei denen das Darknet nicht das zweite Zuhause ist, sondern das erste.
Welche Auswirkungen kann es haben, wenn man von klein auf ungefiltert mit allen Abgründen, die das Internet zu bieten hat, konfrontiert wird? Wie sehr kann die Seele verrohen oder abstumpfen, wenn Videos von Enthauptungen oder von gequälten Katzenbabys so normal sind wie Werbespots? Philipp Winklers neuer Roman „Creep“ porträtiert zwei junge Menschen, bei denen das Darknet nicht das zweite Zuhause ist, sondern das erste.
Zum einen ist da Fanni, Pronomen sie/ihr, wie es in ihrem Social Media-Profil wohl heißen würde. Fannis Kapitel sind konsequent gegendert, wenngleich sie sich sonst wenig um das Thema zu scheren scheint. Außerhalb des binären Geschlechtersystems verortet, fühlt sich Fanni in ihrem Körper wie in einem „Meat Prison“ eingesperrt. Das Internet ist seit Kindheitstagen ihr Fluchtort. „IRL“ arbeitet Fanni in einer Firma, die Überwachungskameratechnik für Privathaushalte anbietet, und ist dort für das Trainieren des Algorithmus zuständig. Hauptmotivation für den morgendlichen Gang zur Arbeit ist aber nicht der Algorithmus, sondern sind Live-Feeds der Überwachungskameras der Kunden, die Fanni wie Reality TV heimlich über ihren Arbeitsmonitor flimmern lässt. Insbesondere eine Familie hat es ihr angetan: die Naumanns. Ohne, dass Mutter, Vater und Tochter Naumann davon wissen, sitzt Fanni mit ihnen tagtäglich am Küchentisch, isst mit ihnen zu Mittag, lauscht ihren Unterhaltungen, lächelt mit in lustigen Situationen, kennt Freunde und Bekannte der Familie – vom Sehen, vom Hören und persönlicher als es diesen sicherlich lieb wäre. Kleiner Nebenverdienst für Fanni sind Kundendaten, die sie sich gern immer mal wieder zieht, um diese im Darknet zu verkaufen. Bis ihr durch Überwachungskamera-Footages irgendwann bewusst wird, dass der Schaden, den sie damit anrichten kann, durchaus real ist.
Opfer werden Täter
Irgendwo über das Überwachungskamera-Material könnte auch Junya huschen, der zweite „Creep“. Obwohl er nicht einmal ansatzweise den Anschein erweckt, führt Junya nachts ein gewalttätiges Doppelleben. Doch ihm das zuzutrauen, fällt schwer. Junya lebt völlig zurückgezogen in seinem verwahrlosten Kinderzimmer. Seine Mutter, zu der er ein zerrüttetes Verhältnis hat, stellt ihm Essen vor sein Zimmer, wäscht seine Wäsche, hat aber sonst jegliche Kontaktversuche aufgegeben, sodass beide zwar in einer Wohnung, aber in völlig unterschiedlichen Welten leben. Junya lebt ansonsten in völliger Isolation – er ist Hikikomori. In Japan bezeichnet man so Menschen, die sich aus der Gesellschaft zurückgezogen und ihren Kontakt zur Außenwelt auf ein absolutes Minimum reduziert haben. Die einzigen Anknüpfungspunkte zur Gesellschaft sind für Junya ein Absageschreiben der örtlichen Kunsthochschule, das er Jahr für Jahr aufs Neue erhält, und Maeda, ein älterer Herr, der ab und an vorbeikommt und mit seinem Anliegen, Junya zu einer Hikikomori-Selbsthilfegruppe mitzunehmen, sehr selten einmal Erfolg hat.
Junya hat andere Wege, seinen Frust und seinen Hass auf die Gesellschaft herauszulassen. Seine persönliche Geschichte ist düster. Die Beziehung zwischen seinen Eltern und ihm war nie von großer Zuneigung geprägt; insbesondere seine Mutter war ihm gegenüber oft gewalttätig. Von Grundschulzeiten an war Junya Opfer extremster Formen des Mobbings, hat viel Ausgrenzung und sehr viel psychische und physische Gewalt erfahren, ohne dass jemand helfend einschritt. Stattdessen fühlte er sich von den Lehrern verraten, die ihm nicht halfen, sondern sogar über Erniedrigungen, die ihm entgegengeschleudert wurden, widerwillig lächeln mussten. Angestachelt von Darknet-Foren, in denen er Zuspruch und Lob erhält, zieht er, mit einer Maske und einem Hammer ausgestattet, los, um sich an Lehrern, die ihn nicht beschützt, sondern verhöhnt haben, zu rächen. Er bricht nachts in Häuser ein und drischt mit seinem Hammer auf die ahnungslos Schlafenden ein. Ein wenig erinnert Junyas Geschichte damit an Todd Phillips‘ „Joker“-Adaption, in der Arthur Fleck als von der Gesellschaft im Stich Gelassener irgendwann selbst zum Täter wird. Eines Nachts wird Junya, der gerade von einem solchen Rachefeldzug zurückkehrt, allerdings jäh aus der ihm vertrauten Umgebung gerissen…
Auch offline immer online
Die vertraute Umgebung ist bei Junya wie auch bei Fanni insbesondere der Computer, ist der Tor-Browser, ist das Darknet, mit seinen Foren und Handelsplattformen. Durch das Dauerfeuer der bildgewaltigen und gewalttätigen Reizüberflutung sind beide emotional völlig abgestumpft, allerdings in unterschiedlichen Graden. Während Junya auch völlig emotionslos filmt, wie er mit dem Hammer Menschen attackiert, ist es für Fanni surreal, eine Schlägerei auf dem Bahnsteig mitzuerleben. Während die anderen Umstehenden wie auch sie allesamt nicht eingreifen, sondern stattdessen gaffen und das Handy zücken, ist Fanni bereits einen Schritt weiter und denkt über passende Headlines zum Video nach.
Das Reallife wird ins Internet gepresst und umgekehrt, in jeder nur möglichen Situation. Während Fanni mit der Tram fährt, denkt sie an Bilder aus einem Subreddit, auf denen Tote der Atombombenexplosion von Hiroshima gezeigt wurden. Oder das, was von ihnen übrig blieb. Steht sie auf einer Firmenfeier, denkt sie an Videos, in denen Hochzeitsgesellschaften in einstürzenden Gebäuden sterben. – Alles an normaler Emotion scheint bei Junya und Fanni gelöscht und überschrieben worden zu sein mit Brutalität und Abgestumpftheit. Mit der Welt und echtem Sozialkontakt können sie nichts mehr anfangen und sehnen sich stattdessen nur noch nach der vertrauten 2D-Umgebung des Computerbildschirms.
Das wird teilweise bis zur Groteske verdreht. So sitzt Fanni nach Feierabend gern im Computerspiel „Dark Souls“ stundenlang an einem See, genießt die Atmosphäre und wünscht sich, dass es im Internet auch irgendwo einen solchen Ort gebe, „von jeglichen Lebenszeichen befreit“, ein Vakuum, „weit weg von den elektrisch knisternden Knotenpunkten und Datenhighways, von den verzweifelten Signalen, die sich die User_innen, großgeschrieben und mit Anführungszeichen verstärkt, zuschreien“. Äh, ja. Aber „Herunterfahren“ scheint ein überflüssiges Feature des Computers zu sein, das bei Fanni ungenutzt bleibt.
Ihr wisst schon… abschalten.
Nach dem starken Debüt-Roman „Hool“, der die Hooligan-Szene porträtiert (und dem schmalen, leider weit dahinter zurückbleibenden Roman „Carnival“, der sich um Kirmes-Schausteller dreht), hat sich Philipp Winkler nun erneut einem Milieu zugewandt, dessen Mitglieder am liebsten unter sich bleiben – einer geschlossenen und verschlossenen Gesellschaft. Auch wenn das Erzähltempo zeitweise nachlässt, ist „Creep“ ein lesenswerter Roman über die Extreme, die eine mediale Dauerbeschallung hervorbringen kann und ein Denkanstoß in Richtung Medienkonsum, insbesondere bei Kindern. Trotz der Darstellung einer Voyeurin ist es dabei glücklicherweise wenig voyeuristisch – „creepy“ ist es dennoch allemal.
Allen, die bei Gender-Unterstrichen nicht gleich schreiend die Wände hochlaufen und denen weder Döskopp-Anglizismen („Dann kommt er auf den Object-Recognition-Algorithmus zu sprechen und darauf, wie satisfied die Führungsetage mit dem Leap sei, den dieser in den vergangenen Monaten noch einmal gemacht habe.“) noch zahlreiche japanische Fremdwörter, die selbst für manchen Otaku herausfordernd sein können, etwas ausmachen, sei der Roman hiermit empfohlen. Er kommt ohne wedelnden moralischen Zeigefinger aus, verbleibt aber dennoch nicht beim „for the lulz“. Um’s mit Fannis Worten zu sagen: Er hinterlässt einen bitteren „Aftertaste“.
♠ Philipp Winkler: Creep. Aufbau Verlag 2022, 342 Seiten, Hardcover, 22 Euro. ISBN: 978-3-351-03725-3. ♠
 Gerade die zweite Hälfte dieses Buches zu lesen, hat in den letzten Tagen ein besonders flaues Gefühl hinterlassen. Aufgeteilt in die großen Kapitel „Davor“, „1933“ und „Danach“ steuerte Florian Illies‘ „Liebe in Zeiten des Hasses“ so oder so auf einen Abgrund der Menschheitsgeschichte zu. Aber mit dem Kriegsausbruch in der Ukraine, mit dem Gefasel seitens Putin von Genozid und „Entnazifizierung“ in der Ukraine, mit Bombenangriffen und Toten tut sich plötzlich auch jetzt wieder ein neuer Abgrund der Geschichte auf.
Gerade die zweite Hälfte dieses Buches zu lesen, hat in den letzten Tagen ein besonders flaues Gefühl hinterlassen. Aufgeteilt in die großen Kapitel „Davor“, „1933“ und „Danach“ steuerte Florian Illies‘ „Liebe in Zeiten des Hasses“ so oder so auf einen Abgrund der Menschheitsgeschichte zu. Aber mit dem Kriegsausbruch in der Ukraine, mit dem Gefasel seitens Putin von Genozid und „Entnazifizierung“ in der Ukraine, mit Bombenangriffen und Toten tut sich plötzlich auch jetzt wieder ein neuer Abgrund der Geschichte auf.
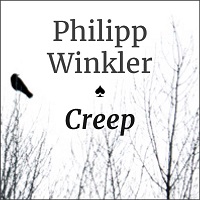 Welche Auswirkungen kann es haben, wenn man von klein auf ungefiltert mit allen Abgründen, die das Internet zu bieten hat, konfrontiert wird? Wie sehr kann die Seele verrohen oder abstumpfen, wenn Videos von Enthauptungen oder von gequälten Katzenbabys so normal sind wie Werbespots? Philipp Winklers neuer Roman „Creep“ porträtiert zwei junge Menschen, bei denen das Darknet nicht das zweite Zuhause ist, sondern das erste.
Welche Auswirkungen kann es haben, wenn man von klein auf ungefiltert mit allen Abgründen, die das Internet zu bieten hat, konfrontiert wird? Wie sehr kann die Seele verrohen oder abstumpfen, wenn Videos von Enthauptungen oder von gequälten Katzenbabys so normal sind wie Werbespots? Philipp Winklers neuer Roman „Creep“ porträtiert zwei junge Menschen, bei denen das Darknet nicht das zweite Zuhause ist, sondern das erste. Religiöser Fanatismus und das Ausbrechen aus engen gesellschaftlichen Konventionen, die dünne Linie zwischen Leben und Tod, enge Freundschaften, durch die ein jäher Riss geht oder die Verdrängung schmerzhafter Ereignisse – das ist nur ein kleiner Auszug aus den schweren Themen, die Dantiel W. Moniz in ihren auf den ersten Blick so leicht daherkommenden Kurzgeschichten thematisiert.
Religiöser Fanatismus und das Ausbrechen aus engen gesellschaftlichen Konventionen, die dünne Linie zwischen Leben und Tod, enge Freundschaften, durch die ein jäher Riss geht oder die Verdrängung schmerzhafter Ereignisse – das ist nur ein kleiner Auszug aus den schweren Themen, die Dantiel W. Moniz in ihren auf den ersten Blick so leicht daherkommenden Kurzgeschichten thematisiert.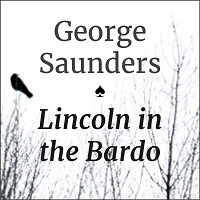 Während im Februar 1862 im Zuge des gerade wütenden Sezessionskriegs auf den Kriegsschauplätzen unzählige Soldaten sterben, stirbt in Washington Abraham Lincolns 11-jähriger Sohn Willie an einer Typhus-Erkrankung. Der von Trauer gezeichnete Präsident kehrt nach der Beerdigung mehrfach zum Grab des Sohnes zurück. Zeitgenössische Zeitungen berichten, dass er den Leichnam seines Sohnes aus dem Sarg nahm, trauernd, niedergeschmettert, verzweifelt. Hieraus entspinnt sich nun George Saunders Idee zu „Lincoln in the Bardo“, wo der Autor den gerade verstorbenen Willie und seinen Vater auf dem Friedhof aufeinandertreffen lässt.
Während im Februar 1862 im Zuge des gerade wütenden Sezessionskriegs auf den Kriegsschauplätzen unzählige Soldaten sterben, stirbt in Washington Abraham Lincolns 11-jähriger Sohn Willie an einer Typhus-Erkrankung. Der von Trauer gezeichnete Präsident kehrt nach der Beerdigung mehrfach zum Grab des Sohnes zurück. Zeitgenössische Zeitungen berichten, dass er den Leichnam seines Sohnes aus dem Sarg nahm, trauernd, niedergeschmettert, verzweifelt. Hieraus entspinnt sich nun George Saunders Idee zu „Lincoln in the Bardo“, wo der Autor den gerade verstorbenen Willie und seinen Vater auf dem Friedhof aufeinandertreffen lässt. „Il male oscuro“ – das dunkle Übel nannte Ingeborg Bachmann die Krankheit, unter der sie seit ihrem Zusammenbruch Ende 1962 litt und für die es zunächst keine passende Diagnose gab. Lange wurde nur nach körperlichen Ursachen geforscht. Dass es auch eine Krankheit der Seele war, verstand auch Bachmann erst spät. Wie sehr die Krankheit ihr Leben, ihr Denken und ihren Alltag bestimmte, bekommt man in „Male oscuro – Aufzeichnungen aus der Zeit der Krankheit“ deutlich zu spüren. Sehr persönliche Schriften aus dem Nachlass von Ingeborg Bachmann sind darin versammelt und erstmals veröffentlich worden, von Beginn des Jahres 1963 bis in die späten 1960er Jahre: Traumnotate, Briefentwürfe an verschiedene Adressaten und zwei Redeentwürfe an „die Ärzteschaft“.
„Il male oscuro“ – das dunkle Übel nannte Ingeborg Bachmann die Krankheit, unter der sie seit ihrem Zusammenbruch Ende 1962 litt und für die es zunächst keine passende Diagnose gab. Lange wurde nur nach körperlichen Ursachen geforscht. Dass es auch eine Krankheit der Seele war, verstand auch Bachmann erst spät. Wie sehr die Krankheit ihr Leben, ihr Denken und ihren Alltag bestimmte, bekommt man in „Male oscuro – Aufzeichnungen aus der Zeit der Krankheit“ deutlich zu spüren. Sehr persönliche Schriften aus dem Nachlass von Ingeborg Bachmann sind darin versammelt und erstmals veröffentlich worden, von Beginn des Jahres 1963 bis in die späten 1960er Jahre: Traumnotate, Briefentwürfe an verschiedene Adressaten und zwei Redeentwürfe an „die Ärzteschaft“. Das Riesenrad dreht sich nicht mehr, die Buden sind weg. Wo früher eine Kirmes stand, sind nun Parkplätze, Einkaufszentren und Industriegebiete. So beginnt sie, die Klage des namenlosen Schaustellers in „Carnival“.
Das Riesenrad dreht sich nicht mehr, die Buden sind weg. Wo früher eine Kirmes stand, sind nun Parkplätze, Einkaufszentren und Industriegebiete. So beginnt sie, die Klage des namenlosen Schaustellers in „Carnival“. Es war die öffentlich zelebrierte Hassliebe zweier großer Persönlichkeiten der deutschen Literatur des 20. Jahrhunderts: die Verbindung zwischen dem Schriftsteller Günter Grass und dem Literaturkritiker Marcel Reich-Ranicki. Zwei Männer, deren Lebensläufe so völlig unterschiedlich verliefen, die über die Literatur aber trotzdem zueinander fanden und sich lieben und hassen lernten.
Es war die öffentlich zelebrierte Hassliebe zweier großer Persönlichkeiten der deutschen Literatur des 20. Jahrhunderts: die Verbindung zwischen dem Schriftsteller Günter Grass und dem Literaturkritiker Marcel Reich-Ranicki. Zwei Männer, deren Lebensläufe so völlig unterschiedlich verliefen, die über die Literatur aber trotzdem zueinander fanden und sich lieben und hassen lernten. Er ist ein Stück zerbrechliche Literatur: der Liebesbrief. Er kann Ausdruck der Sehnsucht, des Vermissens, der Vernarrtheit, der innigen Liebe sein, aber auch Zeugnis von Verbitterung, Verletztheit und Eifersucht. Er kehrt das Innerste nach außen und bannt es auf Papier, nur für einen Adressaten bestimmt.
Er ist ein Stück zerbrechliche Literatur: der Liebesbrief. Er kann Ausdruck der Sehnsucht, des Vermissens, der Vernarrtheit, der innigen Liebe sein, aber auch Zeugnis von Verbitterung, Verletztheit und Eifersucht. Er kehrt das Innerste nach außen und bannt es auf Papier, nur für einen Adressaten bestimmt.
 Deutsch Sprache, schwer Sprache. De Satz ist gut bekannt auch deutschsprachig Aufgewachsenen. Wie schwierig sich gestaltet de Deutschlernen fuer e Fluechtling, de kommt ila Deutschland und will beginnen hier e neu Leben, Abbas Khider schildert in sein „endgueltig“ Lehrbuch „Deutsch fuer alle“. Und er bleibt nicht nur bei de Schilderung, er anbietet ganz praktisch Vorschlaege, mit den de deutsch Sprache kann gestaltet werden weniger kompliziert und fuer Deutschlernende mehr zugaenglich.
Deutsch Sprache, schwer Sprache. De Satz ist gut bekannt auch deutschsprachig Aufgewachsenen. Wie schwierig sich gestaltet de Deutschlernen fuer e Fluechtling, de kommt ila Deutschland und will beginnen hier e neu Leben, Abbas Khider schildert in sein „endgueltig“ Lehrbuch „Deutsch fuer alle“. Und er bleibt nicht nur bei de Schilderung, er anbietet ganz praktisch Vorschlaege, mit den de deutsch Sprache kann gestaltet werden weniger kompliziert und fuer Deutschlernende mehr zugaenglich.