 Man könnte tatsächlich meinen, dass man einen autobiografischen Text vor sich hat, wenn Bret Easton Ellis auf den ersten Seiten des Romans „Lunar Park“ von seinen bisherigen Werken, seiner Karriere als Autor und der wenig herzlichen Beziehung zu seinem Vater berichtet. Doch Zweifel kommen recht schnell auf. Am Camden College hat er also studiert? Gab’s das überhaupt? Da war doch was? Und mit Jayne Dennis ist er verheiratet – die hat zusammen mit Keanu Reeves gedreht. Eine eher unbekannte Schauspielerin?
Man könnte tatsächlich meinen, dass man einen autobiografischen Text vor sich hat, wenn Bret Easton Ellis auf den ersten Seiten des Romans „Lunar Park“ von seinen bisherigen Werken, seiner Karriere als Autor und der wenig herzlichen Beziehung zu seinem Vater berichtet. Doch Zweifel kommen recht schnell auf. Am Camden College hat er also studiert? Gab’s das überhaupt? Da war doch was? Und mit Jayne Dennis ist er verheiratet – die hat zusammen mit Keanu Reeves gedreht. Eine eher unbekannte Schauspielerin?
Nein, nicht existent. Genauso wie Ellis‘ Sohn Robby und seine Stieftochter Sarah ist Jayne Dennis ein fiktionaler Charakter innerhalb eines Romans, der sich um den halbfiktionalen Autor Bret Easton Ellis dreht. Dieser versucht, nach ausschweifenden Drogeneskapaden ein normales Leben anzufangen und zieht zu Jayne Dennis in einen Vorort von New York. Die beiden hatten schon vor vielen Jahren eine Liebschaft, aus der der gemeinsame Sohn Robby hervorging, da Dennis, trotz Ellis‘ Bitten und Flehen das Kind nicht hatte abtreiben wollen. Mehr vorgehalten als überzeugt versucht Ellis nun, eine Beziehung zu seinem Sohn und seiner Stieftochter aufzubauen – sein Scheitern wird regelmäßig bei seinem Psychologen und der Eheberatung thematisiert.
Am Vorabend von Halloween, der Nacht, in der nach vorchristlichem Glauben die Seelen der Toten auferstehen und unter uns wandeln, gibt die „Familie“ eine Halloween-Party. Zu dieser kommen auch viele Studenten des Colleges, an dem Ellis derzeit einmal wöchentlich lehrt und sich im Glanz seines schriftstellerischen Ruhms sonnt. Einer der kostümierten Gäste kommt im blutbespritzten Armani-Anzug als Patrick Bateman, dem Hauptcharakter in Ellis‘ Roman „American Psycho“, zur Party. Dies macht auf den unter dem Einfluss von Kokain und diversen Medikamenten stehenden Ellis einen wenig erfreulichen, vielmehr beklemmenden Eindruck.
Von da an häufen sich die skurrilen Ereignisse. Ellis, der nach der Party bemüht ist, insbesondere die Möbel wieder in die richtige Ordnung zu rücken, sichtet immer häufiger ein Auto, das auch sein inzwischen verstorbener Vater vor über zwanzig Jahren schon besessen hatte. Die Farbe am Haus, das nie neu gestrichen wurde, blättert an einigen Stellen ab und bringt einen darunter verborgenen, lilafarbenen Anstrich zum Vorschein. Nächtliche Schabgeräusche und Kratzspuren an den Türen irritieren die Kinder – und irgendwie scheint das vogelähnliche Kuscheltier von Stieftochter Sarah, der Terby, mehr als nur mechanisch gesteuert zu sein. Seit einiger Zeit bekommt Ellis zudem an manchen Tagen von der Bank, die die Asche seines Vaters aufbewahrt, nachts um 2:40 Uhr eine leere E-Mail zugestellt. In der Bank weiß niemand etwas davon. Spätestens als ein Detective zu Ellis nach Hause kommt und ihn in gedämpftem Ton warnt, dass in der Umgebung ein Serienmörder umgeht, der sich offenbar Patrick Bateman als Vorbild genommen hat und die Morde aus „American Psycho“ nun wirklich begeht, ist Ellis alarmiert. Und starke Beruhigungstabletten mit Wodka mischend überlegt er, was zu tun ist.
„Lunar Park“ ist nach Aussage von Bret Easton Ellis eine Hommage an Stephen King und die Comicbücher, die Ellis als Kind gern las. Er vereint Charaktere vorheriger Romane und stellt auch diesem Roman wieder eine promiske Hauptfigur mit exzessivem Drogenkonsum und ohne festen Platz in der Gesellschaft voran. Auch ist „Lunar Park“ eine Parodie auf die zeitgenössische amerikanische Gesellschaft, insbesondere bezogen auf den Umgang der Upper Class-Eltern mit ihren Kindern. Sogar die beiden Kinder des fiktionalen Bret Easton Ellis stehen die meiste Zeit unter dem Einfluss von Beruhigungsmitteln, sitzen zeitweise einfach nur lethargisch herum und starren ins Leere. Seine Gesellschaftskritik ist zwar deutlich schwächer als in „American Psycho“ oder „Less Than Zero“, macht aber dennoch den Reiz dieses Werks aus, ebenso das Auftauchen altbekannter Charaktere. Die Hommage an Stephen King ist dem Roman deutlich anzumerken – ob die Mischung von klassischem Ellis-Ton mit ebenso klassischen Horror-Merkmalen gelungen ist, sei jedoch dahingestellt. Der Roman ist eine Gratwanderung und erweitert das Repertoire von Ellis‘ Werken um ein doch eher unvermutetes Genre.
♠ Bret Easton Ellis: Lunar Park. Vintage 2006, 416 Seiten, Taschenbuch, 6,30 Euro (ohne Preisbindung). ISBN: 978-0307276919. ♠



 Über diesen Roman muss man wirklich nicht mehr viel sagen. Mit seinen hundert Jahren ist der immer noch recht agile Allan Karlsson im letzten Jahr munter die Bestsellerliste hinauf- und in diesem Jahr irgendwann wieder ganz langsam hinuntergeklettert. Und das zurecht. Wenn man den eher schleppenden Anfang einmal hinter sich gebracht hat, entwickelt sich der Roman bald zu einem amüsanten, ein wenig morbidem Roadmovie, das nicht nur Allan Karlssons Flucht aus dem Altersheim verfolgt, sondern seine hundert Jahre umfassende Lebensgeschichte in ihren unterschiedlichen Etappen präsentiert. Nicht selten kommt das Gefühl auf, man verfolge eine alternative Version von Forrest Gumps Vita, wenn Allan mal mit Mao Tse Tung, mal mit Stalin oder Charles de Gaulle sein Schnäpschen trinkt. In jedem Fall ist der Roman ein witziger Parforceritt durch das letzte Jahrhundert, mal mehr, mal weniger historisch akkurat.
Über diesen Roman muss man wirklich nicht mehr viel sagen. Mit seinen hundert Jahren ist der immer noch recht agile Allan Karlsson im letzten Jahr munter die Bestsellerliste hinauf- und in diesem Jahr irgendwann wieder ganz langsam hinuntergeklettert. Und das zurecht. Wenn man den eher schleppenden Anfang einmal hinter sich gebracht hat, entwickelt sich der Roman bald zu einem amüsanten, ein wenig morbidem Roadmovie, das nicht nur Allan Karlssons Flucht aus dem Altersheim verfolgt, sondern seine hundert Jahre umfassende Lebensgeschichte in ihren unterschiedlichen Etappen präsentiert. Nicht selten kommt das Gefühl auf, man verfolge eine alternative Version von Forrest Gumps Vita, wenn Allan mal mit Mao Tse Tung, mal mit Stalin oder Charles de Gaulle sein Schnäpschen trinkt. In jedem Fall ist der Roman ein witziger Parforceritt durch das letzte Jahrhundert, mal mehr, mal weniger historisch akkurat.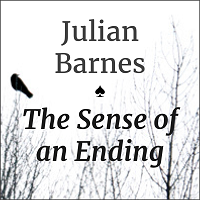
 Ja, das kommt davon, wenn man erst einmal knapp zwei Jahre wartet und anderen Büchern zunächst den Vortritt lässt, da man auf die Taschenbuch-Ausgabe wartet. Dann verpasst man knapp zwei Jahre lang einen verdammt guten Roman. Aber man kann es nachholen. Und das sollte man auch.
Ja, das kommt davon, wenn man erst einmal knapp zwei Jahre wartet und anderen Büchern zunächst den Vortritt lässt, da man auf die Taschenbuch-Ausgabe wartet. Dann verpasst man knapp zwei Jahre lang einen verdammt guten Roman. Aber man kann es nachholen. Und das sollte man auch. Leo Arimond, zum Zeitpunkt der Handlung 17-jährig, schießt beim Fußballtraining über das Spielfeld hinaus und katapultiert den Ball in den nahegelegenen Fluss. Während er versucht, den Ball aus der Strömung zu fischen, treibt ein roter Hut an ihm vorbei und den Fluss hinab, ein Hut, den er sofort als den seiner Bekannten Lia wiedererkennt.
Leo Arimond, zum Zeitpunkt der Handlung 17-jährig, schießt beim Fußballtraining über das Spielfeld hinaus und katapultiert den Ball in den nahegelegenen Fluss. Während er versucht, den Ball aus der Strömung zu fischen, treibt ein roter Hut an ihm vorbei und den Fluss hinab, ein Hut, den er sofort als den seiner Bekannten Lia wiedererkennt. Da liest man und liest, man wartet und wartet auf die Passagen, die einem doch bestätigen müssen, dass da etwas ideologisch Fragwürdiges im Buch sei. Da hat man von dieser Diskussion gehört, von Für- und Gegenstimmen und hat es nicht weiter verfolgt, man hat das Buch ja da und will es selbst noch lesen. Und man liest und liest, aber da ist nichts. Dann wundert man sich: Ist man etwa nicht feinfühlig genug? Versteht man all diese mit Ironie gespickten Anspielungen etwa vollkommen falsch?
Da liest man und liest, man wartet und wartet auf die Passagen, die einem doch bestätigen müssen, dass da etwas ideologisch Fragwürdiges im Buch sei. Da hat man von dieser Diskussion gehört, von Für- und Gegenstimmen und hat es nicht weiter verfolgt, man hat das Buch ja da und will es selbst noch lesen. Und man liest und liest, aber da ist nichts. Dann wundert man sich: Ist man etwa nicht feinfühlig genug? Versteht man all diese mit Ironie gespickten Anspielungen etwa vollkommen falsch? Wenn man von einem oder gleich mehreren Romanen eines Autors hellauf begeistert ist, neigt man gern einmal zu einem Blindkauf, sobald dieser Autor ein neues Buch auf den Markt bringt. Oftmals bestätigt sich dann die Hoffnung und man hat einen würdigen Nachfolger in den Händen. Aber in manchen Fällen mag man das Geld für den Kauf des Buches nach dem Lesen fast bereuen.
Wenn man von einem oder gleich mehreren Romanen eines Autors hellauf begeistert ist, neigt man gern einmal zu einem Blindkauf, sobald dieser Autor ein neues Buch auf den Markt bringt. Oftmals bestätigt sich dann die Hoffnung und man hat einen würdigen Nachfolger in den Händen. Aber in manchen Fällen mag man das Geld für den Kauf des Buches nach dem Lesen fast bereuen. Von Anfang an ist klar, dass etwas faul ist. Etwas stimmt nicht mit der Reise, die die Erzählerin in „Meeresrand“ mit ihren zwei kleinen Söhnen macht. Einmal das Meer sehen sollen sie, einmal eine Reise machen – etwas, das sich die Mutter vorher nie leisten konnte. Und so misstrauisch wie die der neunjährige Stan und der fünfjährige Kevin ist auch der Leser.
Von Anfang an ist klar, dass etwas faul ist. Etwas stimmt nicht mit der Reise, die die Erzählerin in „Meeresrand“ mit ihren zwei kleinen Söhnen macht. Einmal das Meer sehen sollen sie, einmal eine Reise machen – etwas, das sich die Mutter vorher nie leisten konnte. Und so misstrauisch wie die der neunjährige Stan und der fünfjährige Kevin ist auch der Leser.