


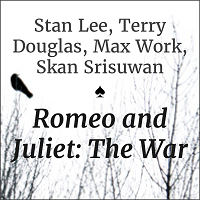 Stan Lee, Mastermind der Superheldenschmiede Marvel Comics, hat vor Kurzem, in Kooperation mit der YouTube-Gruppe „How It Should Have Ended“, sein persönliches „How It Should Have Ended“ veröffentlicht. Hier präsentiert er seine Vorstellung von besseren Ausgängen bekannter Filme, bis hin dazu, dass er die Manuskripte von Episode I bis III von Star Wars aus George Lucas‘ Händen reißt und in den Kamin schmeißt.
Stan Lee, Mastermind der Superheldenschmiede Marvel Comics, hat vor Kurzem, in Kooperation mit der YouTube-Gruppe „How It Should Have Ended“, sein persönliches „How It Should Have Ended“ veröffentlicht. Hier präsentiert er seine Vorstellung von besseren Ausgängen bekannter Filme, bis hin dazu, dass er die Manuskripte von Episode I bis III von Star Wars aus George Lucas‘ Händen reißt und in den Kamin schmeißt.
In der Graphic Novel „Romeo and Juliet: The War“ hingegen legt er zusammen mit Terry Douglas, Max Work und Skan Srisuwan ein „How It Could Have Been“ hin. Die Autoren- und Illustratorengruppe verlegt dazu die Handlung von Shakespeares „Romeo und Julia“ in ein Endzeit-Szenario, das einige hundert Jahre nach unserer Zeit spielt. Auch hier gilt die wohlbekannte Einleitung Shakespeares:
Two households, both alike in dignity,
In fair Verona, where we lay our scene,
From ancient grudge break to new mutiny,
Where civil blood makes civil hands unclean.
(William Shakespeare: Romeo and Juliet)
Auch hier sind die beiden households die Montagues und die Capulets – mit ein paar Unterschieden. Die Montagues sind eine Gruppe genetisch manipulierter Menschen, deren DNA auf Metall übertragen wurde, sodass sie stärker und widerstandsfähiger als herkömmliche Menschen sind. Geschaffen wurden sie von Dr. Montague, der einen Weg suchte, seinen verlorenen Arm wiederherzustellen und so durch Zufall auf diese Form der Kybernetik stieß. (Eine Geschichte, die in nicht gerade unauffälliger Weise an The Amazing Spider-Man erinnert.) Die durch Dr. Montagues Entdeckung verbesserten Menschen werden – wie sollte es anders sein – vom Militär angeheuert und als Spezialwaffen genutzt.
Auf der anderen Seite steht – wer hätte es gedacht – Dr. Capulet. Er findet die Montagues geschmacklos und entwickelt seinerseits eine Möglichkeit, den menschlichen Körper ohne den Einsatz von Metall physisch und mental zu verbessern. Den so entstehenden Capulets ist es möglich, höher zu springen und schneller zu laufen, wenngleich sie auch nicht so stark sind wie die Montagues. Auch sie werden als auf ihre Weise effektive Soldaten vom Militär angeheuert. Durch die vereinten Kräfte der Montagues und Capulets wird Verona zur mächtigsten Stadt der Erde. Die Kriege werden beendet, das Volk feiert – nur die Montagues und Capulets haben nun keinen gemeinsamen Feind mehr. Daher müssen sie sich, geschaffen um zu kämpfen, einen neuen Feind suchen und bekämpfen sich im Folgenden dementsprechend gegenseitig.
So viel zur Rahmenhandlung. Die Geschichte von Romeo und Julia in diesem Szenario zu verorten, dürfte ein Leichtes sein.
Optisch ist die vorliegende Graphic Novel wahrlich bombastisch. Allein schon durch die Größe (die Seitenlänge beträgt 26 mal 33,4 Zentimeter) bietet das Werk viel Platz für großflächige, detaillierte Zeichnungen, die man lange betrachten, die man sich fast ausschneiden und an die Wand hängen möchte. Auch die in der Rahmenhandlung angelegte, düstere Endzeitstimmung wird durch die Zeichnungen sehr stimmig transportiert. Und auch Stan Lees Cameo-Auftritt, der in Marvel-Filmen schon zur Selbstverständlichkeit geworden ist, fehlt hier nicht.
Einzig die Handlung leidet. Sicher, die Geschichte von Romeo und Julia ist hinlänglich bekannt, dennoch wird sie in diesem Werk deutlich verknappt und viel zu schnell erzählt. Generell sind längere Textpassagen kaum zu finden, die Dialoge wirken teils ziemlich steif und die Charaktere bleiben leider größtenteils oberflächlich. Die in den einleitenden Worten von Shakespeare angedachten two hours‘ traffic, die das Stück einnehmen soll, könnten gerade ausreichen, um „Romeo und Juliet: The War“ durchzulesen, durchzuschauen. Aber auch das wird knapp, selbst wenn man die einzelnen Seiten und Artworks lange auf sich wirken lässt. Alles scheint insbesondere für den optischen Eindruck produziert worden zu sein, der auch – und das ist insbesondere dem Art Director Skan Srisuwan zu verdanken – unbestrittenermaßen großartig ist.
Ergo: So weit, den Autoren das Skript aus den Händen zu reißen und in den Kamin zu werfen, sollte und möchte man keinesfalls gehen. Nur wären, um auch der Handlung gerecht zu werden, noch ein paar Dutzend mehr dieser optisch herausragenden Seiten wünschenswert gewesen. Denn visuell ist diese Graphic Novel in jedem Fall ein Meisterwerk, das im Regal einen Ehrenplatz verdient.
♠ Stan Lee, Terry Douglas, Max Work, Skan Srisuwan: Romeo and Juliet: The War. Viper Comics 2011, 140 Seiten, Taschenbuch, 16,99 Euro (ohne Preisbindung). ISBN: 978-0983935001. ♠

Wir sprechen einen Namen aus und treten, da die Wände durchlässig sind, in ihre Zeit ein, erwünschte Begegnung, ohne zu zögern erwidert sie aus der Zeittiefe heraus unseren Blick. Kindsmörderin? Zum erstenmal dieser Zweifel. Ein spöttisches Achselzucken, ein Wegwenden, sie braucht unseren Zweifel nicht mehr, nicht unser Bemühen, ihr gerecht zu werden, sie geht.
In der griechischen Mythologie segelt Jason mit der »Argo« nach Kolchis, um dort das Goldene Vlies zurück zu erlangen – das goldene Fell eines Widders, das dem König von Kolchis einst als Geschenk überreicht wurde. Mithilfe von Medea, der Tochter des Königs von Kolchis, gelingt es Jason, das Goldene Vlies zu rauben. Medea flieht daraufhin zusammen mit Jason aus ihrer Heimatstadt und gelangt so nach Korinth. Die beiden werden ein Paar und bekommen zwei Söhne.
Sowohl das Drama »Medea« von Euripides als auch Christa Wolfs Roman setzen an dieser Stelle an. In der griechischen Mythologie, erstmals durch Euripides überliefert, wird Medea von Jason verlassen, da diesem die Tochter des Königs von Korinth versprochen wird. Aus der Schmach heraus, verlassen worden zu sein, tötet Medea daraufhin ihre Rivalin, deren Vater und ihre eigenen Kinder, um sich an Jason zu rächen.
Doch Christa Wolf erzählt eine andere Geschichte. Medea wird hier nicht als rachsüchtige Mörderin dargestellt, sondern als das Opfer der Machtspielereien rund um das Königshaus von Karthago. Die Stimmen von sechs verschiedenen Akteuren lässt Christa Wolf sprechen. Die Stimmen geben uns einen Einblick in ihre Gedankenwelt, aus der heraus sich die Handlung des Romans konstruiert. Das Bild der wütenden Giftmischerin Medea wird korrigiert und kunstvoll mit dem mythologischen Hintergrund zusammengeführt, sodass sich ein ganz anderes Bild dieser Sage ergibt. Medea wird zur stolzen, charakterstarken Frau, die manchmal ein wenig übernatürlich wirkt; als stünde sie schon lange über den Dingen, und als wisse sie, was das Schicksal für sie schon lange bereit hält.
Gerade die unterschiedlichen Blickwinkel der »Stimmen« machen diesen Roman reizvoll. Immer stärker verstrickt sich die Geschichte in Lügen und Anfeindungen, werden Intrigen gesponnen, verfallen die Einwohner Karthagos in einen Wahn aus Verleumdungen und panischer Fremdenfeindlichkeit. Am Ende möchte man sagen: Ja, das Bemühen, ihr gerecht zu werden war erfolgreich. Diese Medea, um einiges vielschichtiger als in der Überlieferung, scheint die richtige, die wahre Medea zu sein.
♠ Christa Wolf: Medea. Stimmen. Suhrkamp 2008, 223 Seiten, Taschenbuch, 8,00 Euro. ISBN: 978-3518460085 (Jahr der Erstausgabe: 1996). ♠
 Nein, mit der Farbe Indigo hat dieser Roman im Grunde nichts zu tun. Vielmehr adaptiert er eine Idee aus der Esoterik, nach der es Kinder gibt, die übersinnliche Eigenschaften besitzen. Der Theorie zufolge sind diese an einer indigofarbenen Aura zu erkennen und um diese sogenannten Indigo-Kinder dreht sich Setz‘ Roman. Auch wenn das indigofarbene Erkennungsmerkmal fehlt, greift er das Konzept von übernatürlichen psychischen Fähigkeiten auf und konstruiert eine Welt, in der das Indigo-Syndrom bereits zum Alltag gehört. Wie das iPhone und der iPod ist hier das iKind zu einer alltäglichen Bezeichnung geworden, die keiner weiteren Erklärung bedarf. Offenbar.
Nein, mit der Farbe Indigo hat dieser Roman im Grunde nichts zu tun. Vielmehr adaptiert er eine Idee aus der Esoterik, nach der es Kinder gibt, die übersinnliche Eigenschaften besitzen. Der Theorie zufolge sind diese an einer indigofarbenen Aura zu erkennen und um diese sogenannten Indigo-Kinder dreht sich Setz‘ Roman. Auch wenn das indigofarbene Erkennungsmerkmal fehlt, greift er das Konzept von übernatürlichen psychischen Fähigkeiten auf und konstruiert eine Welt, in der das Indigo-Syndrom bereits zum Alltag gehört. Wie das iPhone und der iPod ist hier das iKind zu einer alltäglichen Bezeichnung geworden, die keiner weiteren Erklärung bedarf. Offenbar.
Doch wie äußern sich die Kennzeichen eines iKindes? Auch im Roman sind die betroffenen Kinder von einer Aura umgeben, die, wenn auch unsichtbar, von anderen Menschen umgehend bemerkt wird. Denn kommt einem nicht betroffenen Menschen eine iPerson zu nahe, hat dies extreme körperliche Auswirkungen zur Folge. Der nicht betroffenen Person wird enorm schnell schwindelig, ein starker Brechreiz und Kopfschmerzen treten auf. Gelinde gesagt ist die Gegenwart eines Indigo-Menschen nicht auszuhalten. Besonders bei Kindern ist das Syndrom stark ausgeprägt, im Alter lässt es vielfach nach.
Das Syndrom ist in Setz‘ Roman stark verbreitet. Oft werden Betroffene als „Dingos“ beschimpft, sie leben isoliert und haben, je nach Intensität der Aura, oftmals auch zu den eigenen Eltern nur notdürftigen Kontakt, da auch diese die Anwesenheit des iKindes kaum ertragen können.
Im Blickpunkt des Romans steht Robert, ein junger Erwachsener, bei dem das Indigo-Syndrom über die Jahre immer schwächer geworden ist – ein ausgebrannter Fall. Er lebt mit seiner Freundin zusammen und ist geprägt von einer manchmal kaum zu kontrollierenden inneren Wut und einem übermäßigen Hang zum Sadismus. Roberts Freundin baut ihm, wenn er sich anders nicht abreagieren kann, kleine Wuthäuschen, die er bei Bedarf zerstören kann. Generell findet er Gefallen an Berichten, Filmen oder Fotos, die beispielsweise Tierquälereien zeigen, und wirkt auf andere dadurch sowohl verstört als auch verstörend.
Die zweite Hauptfigur der Erzählung ist das fiktive Alter Ego des Autors: der Mathematiklehrer Clemens Setz. Er macht ein Praktikum in einer auf iKinder spezialisierten Schule und wird dort auf äußerst seltsame Vorfälle aufmerksam: auf das merkwürdige Verhalten der iKinder untereinander, auf den exzentrischen Leiter des Instituts und insbesondere auf das plötzliche Verschwinden von Kindern. Setz macht sich daran, die Hintergründe des Syndroms zu studieren und nach dem Verbleib der Kinder zu forschen. Dabei verstrickt er sich immer tiefer in eine Geschichte, die von Seite zu Seite skurriler wird.
Eine generelle Skurrilität ist das Leitmotiv dieses Romans. Vom Indigo-Syndrom selbst einmal abgesehen, verwendet Setz vielfach Begriffe, die erst viel später oder nur indirekt aus dem Kontext heraus erklärt werden – manchmal aber auch einfach gar nicht. Die Protagonisten Clemens Setz und Robert bleiben beide auf ihre Art und Weise rätselhaft. Wo Robert sich übermäßig am Leid anderer erfreut, ist Setz das genaue Gegenteil, und zart besaitet wendet er sich beim geringsten Anzeichen von Gewalt oder Grauen umgehend ab. Auch der Umgang mit nahestehenden oder fremden Menschen ist bei beiden nur schwer nachvollziehbar. Immer wieder streut der Autor zudem merkwürdige Details von außergewöhnlichen Menschen oder Begebenheiten ein, von der Ausrottung der Dodos über Hunde im Weltall bis hin zum einsamsten Baum der Welt.
Begleitend dazu spickt Setz den Roman mit zahlreichen Anspielungen auf das Science-Fiction- und das Comic-Genre. So denkt Robert oftmals an fragwürdige Sinnsprüche vom von Adam West verkörperten Batman der klassischen 1960er Jahre-Serie und unterhält sich mit Bekannten ausgiebig über Star Wars. Und insbesondere Star Wars scheint auf Setz einen großen Einfluss gehabt zu haben. Wohl kaum zufällig thematisiert Robert auch die Midi-Chlorianer, deren Konzentration im Körper bei Star Wars dafür verantwortlich ist, wie empfänglich die jeweilige Person für die Macht ist. Setz überträgt die Macht auf die iKinder – doch ist die Macht in Star Wars vielfältig anwendbar, so ist das Indigo-Syndrom im Roman salopp gesagt nur „zum Kotzen“.
Die Grundidee hat durchaus ihre Reize. Doch krankt „Indigo“ insbesondere daran, dass in weiten Teilen des Romans schlichtweg gar nichts passiert. Wie eine fortwährende Zustandsbeschreibung ohne fortlaufende Handlung dreht sich alles um die Konstruktion des Seltsamen, Befremdlichen. Dabei ist aber so manches Element, das seitens Setz wohl verstörend wirken soll, für Horror zu schwach, für Interesse des Lesers aber auch zu unerklärt. Zudem wirkt auch die Sprache übermäßig konstruiert und beginnt schon vor dem x-ten „wie“-Vergleich, anstrengend zu werden.
Interessant andererseits ist der Roman durch seine Drucklegung: So werden nicht nur passend zu Ausschnitten aus wissenschaftlichen Aufsätzen Bilder abgedruckt, es wird auch vielfach mit Schriftarten gespielt. Bei älteren Artikeln wird beispielsweise Fraktur genutzt, die Inhaltsangabe zu Beginn des Buchs ist in Setz‘ Handschrift verfasst. Ein schöner Effekt, der aber nicht sonderlich dabei hilft, sich durch den zähen Inhalt von „Indigo“ zu schleppen. Viel zu ertragen der Leser hier manchmal hat, wenn bis zur letzten Seite er sich kämpfen will.
♠ Clemens J. Setz: Indigo. Suhrkamp 2012, 479 Seiten, gebunden, 22,95 Euro. ISBN: 978-3518423240 ♠
 Dieser Roman sollte einen Warnhinweis tragen: „Bitte in ruhiger Umgebung beginnen.“ Denn auch wenn der Titel es nicht auf Anhieb verrät, führt er es doch direkt beispielhaft vor: Dieser Roman hat keinen Ich- oder Er-Erzähler, hier erzählt „man“.
Dieser Roman sollte einen Warnhinweis tragen: „Bitte in ruhiger Umgebung beginnen.“ Denn auch wenn der Titel es nicht auf Anhieb verrät, führt er es doch direkt beispielhaft vor: Dieser Roman hat keinen Ich- oder Er-Erzähler, hier erzählt „man“.
„Man“ ist Karl Kolostrum, genannt Charlie, der zu Beginn des Romans sechzehn ist und den der Leser durch die wildesten Jahre seiner späten Pubertät und der darauffolgenden Studentenzeit begleitet. Charlie ist dick und in der Schule nicht gerade der Beliebteste. Das Verhältnis zu seiner oft betrunkenen Mutter ist distanziert, ein Vater ist nicht vorhanden. Generell eher ratlos darüber, was das Leben mit ihm vorhat, ist Charlie jedoch ein Profi, wenn es um Ratgeberlektüre jeder Art und Nachschlagewerke zur Lebenshilfe geht. Unentwegt zitiert er mal aus „Die Persönlichkeit“, „Der Körper“, „Die große Geschichte der Rockmusik, psychologisch betrachtet“ oder ähnlichen Anlaufstellen Ratsuchender und streut auch hin und wieder eigene Merksätze ein. Große Erkenntnisse manifestiert er darin allerdings nicht und auf seinem Lebenswerk helfen ihm seine Merksprüche auch nur wenig weiter. Ohne einen großen Plan vom Leben stoplert Charlie durch die Welt, lässt sich mehr tragen als dass er selbst geht. Verwunderlich ist das nicht: Immerhin hat der Multiple Choice-Test eines seiner Ratgeber ergeben, dass er ein 86%iger Sitzer ist. Also sitzt Charlie es aus. Und die Situationen, in die der Sitzer Charlie ungewollt gerät, sind nicht immer nur das alltägliche Lebenschaos eines Heranwachsenden. Als die betrunkene Mutter die Nachbarin verprügelt und Charlie seine Mutter vor Gericht deckt, hat er das erste Mal Kontakt zur Justiz – dabei bleibt es allerdings nicht. Hinzu gesellt sich über die Zeit der ein oder andere Mord, wenn auch versehentlich, und die Auswirkungen dieser Morde lenken Charlie in immer wieder neue Bahnen – und sei es auch nur durch den unverhofften Geldsegen einer dadurch frühzeitig erhaltenen Erbschaft.
Sicher – wenn man Karl Kolostrum heißt, ist es vielleicht nachvollziehbar, wenn man sich in völliger Selbstentfremdung nur noch als „man“ bezeichnet. Gleichzeitig zur Ichentfremdung Charlies gelingt dem Autor Thomas Glavinic der Eindruck, das alles, was Charlie unternimmt, verallgemeinert wird und jeden einbezieht. Charlies Leben wird zu einem umfassenden Ratgeber dafür, wie man sich in den unterschiedlichsten Situationen verhalten sollte oder verhalten könnte.
Es kann etwas dauern, sich in diesen Roman einzulesen, da anfangs das Gefühl aufzukommen droht, dass der Stil stetig den Inhalt überdeckt und vom Wesentlichen ablenkt. Wenn es nach einer Weile aber nicht mehr auffällt, dass hier ein „man“ erzählt, achtet man deutlicher auf den amüsanten, ironischen, teils absurden Inhalt. „Wie man leben soll“ ist ein wenig Popliteratur, ein wenig Entwicklungsroman – in jedem Fall kurzweilig und empfehlenswert.
♠ Thomas Glavinic: Wie man leben soll. dtv 2010, 240 Seiten, Taschenbuch, 8,90 Euro. ISBN: 978-3423139038. ♠
 Es gibt da so ein Hobby. Man nimmt sich ein Handy oder ein Gerät, das diesem mitunter recht ähnlich sehen kann, zieht in die weite Welt hinaus und sucht ein Döschen. Dabei kann man durch Wald und Wiesen streifen oder auch mitten in der Stadt umherlaufen – Dosen gibt es zuhauf. Nebenbei lernt man eventuell etwas über bisher unbekannte Brückenbauer oder zählt Säulen an Gebäuden, um an Koordinaten herumzurechnen. Oder man hält sich während der Suche auch ohne Gesprächspartner sein Handy ans Ohr, weil jemand Uneingeweihtes (ein Muggel!) schräg guckt, da man ständig aufs Display schaut und sich suchend umsieht. Und dann? Findet man irgendwann die Dose, versteckt hinter Steinen, unter Steinen oder in Steinen, holt einen meist recht dicht beschriebenen Papierstreifen heraus, trägt einen Namen, Datum und Uhrzeit ein, legt alles wieder zurück und freut sich. DfdC! – Danke für den Cache!
Es gibt da so ein Hobby. Man nimmt sich ein Handy oder ein Gerät, das diesem mitunter recht ähnlich sehen kann, zieht in die weite Welt hinaus und sucht ein Döschen. Dabei kann man durch Wald und Wiesen streifen oder auch mitten in der Stadt umherlaufen – Dosen gibt es zuhauf. Nebenbei lernt man eventuell etwas über bisher unbekannte Brückenbauer oder zählt Säulen an Gebäuden, um an Koordinaten herumzurechnen. Oder man hält sich während der Suche auch ohne Gesprächspartner sein Handy ans Ohr, weil jemand Uneingeweihtes (ein Muggel!) schräg guckt, da man ständig aufs Display schaut und sich suchend umsieht. Und dann? Findet man irgendwann die Dose, versteckt hinter Steinen, unter Steinen oder in Steinen, holt einen meist recht dicht beschriebenen Papierstreifen heraus, trägt einen Namen, Datum und Uhrzeit ein, legt alles wieder zurück und freut sich. DfdC! – Danke für den Cache!
Wenn man dieses Hobby kennt, eventuell selbst ausübt und dann ein Buch zur Hand nimmt, bei dem die Kapitel mit Koordinaten überschrieben sind, mag man es direkt ahnen: „Fünf“ ist ein Geocaching-Thriller. Auf einer Wiese in der Nähe von Salzburg wird die Leiche einer Frau gefunden. Die heraneilende Ermittlerin Beatrice Kaspary entdeckt Koordinaten, die auf der Fußsohle des Opfers eintätowiert wurden. Zusammen mit ihrem Kollegen fährt sie zum angegebenen Ort und findet, ohne dass sie auch nur die geringste Ahnung hat, wonach die Ausschau halten muss, nach einer Weile eine Frischhaltedose mit bizarrem Inhalt: In der Box befinden sich eine eingeschweißte Hand und zwei Schreiben. Im ersten Schreiben wird dazu gratuliert, dass man fündig geworden ist. Das zweite Schreiben jedoch enthält eine Rätselaufgabe – für “Stage 2”. Muggel Beatrice ist perplex. Bevor sie lange zu grübeln hat, wird Beatrice von einem weiteren Kollegen darüber aufgeklärt, was Geocaching ist. Der Täter, der die Dose mitsamt Hand versteckt hat und der mutmaßliche Mörder der aufgefundenen Frau ist, scheint das Geocachen für seine eigenen Zwecke zu pervertieren. Also machen sich Beatrice und ihre Kollegen auf die Suche nach der nächsten Stage.
Zugegebenermaßen kommt die Rätselei um Stage 2 nur sehr stockend in Gang. Die Autorin hat sich viel Zeit gelassen um die Hauptfigur Beatrice zu porträtieren und um langsam in das Thema Geocaching einzuführen – für den Leser wird das teilweise zur Geduldsprobe. Auch im weiteren Verlauf hat man oft das Gefühl, dass entscheidende Punkte künstlich hinausgezögert werden. Die Suche der Polizeibeamten nach den Lösungen der einzelnen Stages ist eher ermüdend, und dass in jeder erdenklichen Situation zum gefühlt tausendsten Mal Beatrices Essgewohnheiten, vorhandener oder fehlender Hunger thematisiert werden, rettet den Spannungsbogen nicht im geringsten.
Der thrill dieses Thrillers fehlt zunächst – aber er stellt sich ein. Später. Es dauert eine ganze Weile, aber wenn nach und nach alle Fäden zusammenlaufen, wird der ausdauernde Leser mit einer zum Schluss recht spannenden, solide konstruierten Geschichte belohnt. Für alle, die mit Geocaching zuvor nicht vertraut waren, ist es eine etwas andere Einführung in ein potenzielles neues Hobby, bei dem glücklicherweise nur Dosen mit harmlosem Inhalt zu suchen sind. Die Thematik wird einigermaßen gut ausgeschöpft, man muss nur am Ball bleiben. Aber einen Cache findet man ja auch nicht immer direkt. Manchmal muss man erst diverse Steine dafür umdrehen.
♠ Ursula Poznanski: Fünf. Wunderlich 2012, 384 Seiten, broschiert, 14,95 Euro. ISBN: 978-3805250313. ♠
 Rosarius Delamot ist kein gewöhnlicher Erzähler. Seine gesamte Kindheit und Jugend über sprach Rosarius kein Wort, teilte sich nur in stetigem Summen mit. Er war ein Sonderling, konnte nicht mit anderen Kindern seines Alters zur Schule gehen – erst mit 23 Jahren fing er zögerlich an zu sprechen.
Rosarius Delamot ist kein gewöhnlicher Erzähler. Seine gesamte Kindheit und Jugend über sprach Rosarius kein Wort, teilte sich nur in stetigem Summen mit. Er war ein Sonderling, konnte nicht mit anderen Kindern seines Alters zur Schule gehen – erst mit 23 Jahren fing er zögerlich an zu sprechen.
Mittlerweile in einem Seniorenheim wohnend, blickt Rosarius auf sein Leben zurück und erzählt seine Geschichte, die – wie auch andere Romane von Norbert Scheuer – größtenteils in der Eifel spielt. Parallel dazu wird von Annie erzählt, der knapp 30-jährigen Altenpflegerin, die sich geradezu hingebungsvoll um Rosarius kümmert. Der Leser begleitet sie bei ihrer Arbeit, beim Abschied von gestorbenen Bewohnern des Seniorenheims, beim Beobachten ihrer heimlichen Liebe, einem jungen, von Annie Bellarmin genannten Mann, der ebenfalls für das Seniorenheim arbeitet – und bei den vielen Stunden, die sie bei Rosarius verbringt.
Rosarius‘ Geschichte ist, wie man schon vermuten kann, keine gewöhnliche. Seine Mutter Kathy scheint selbst der Welt ein wenig entrückt zu sein, ihr Liebhaber Vincentini ist es nicht weniger. Er ist ein fliegender Händler, der nach dem Krieg sein Geld insbesondere mit dem Verkauf eines Wunderheiler-Instruments namens „Perseus“ verdient – einem Gerät, das durch die Einwirkung von Strom angeblich alles zu heilen vermag. Rosarius begleitet Vincentini oftmals auf seinen Handelsreisen, zunächst als stiller Begleiter, der im Auto wartet, später auch als Anschauungsobjekt für die mutmaßlichen Erfolge des „Perseus“. Auch fährt Rosarius oft bei dem Lkw-Fahrer Karl Höger mit. Zusammen unternehmen sie Fantasiereisen, in denen sie mit dem Laster durch sämtliche Kontinente fahren und auch Erdachtes wird für Rosarius zur Realität. Wenn Karl Höger erzählt, dass sie gerade über die Golden Gate Bridge gefahren sind, dann werden Fantasie und Wirklichkeit für Rosarius gleichbedeutend. Ab und an wird auch von Rosarius‘ Vater berichtet, einem Archäologen, der den alten Straßen und Handelswegen der Antike quer durch Europa und den Nahen Osten gefolgt ist. Seine Reiseberichte sind illustre Einsprengsel in der Erzählung.
Und dann ist da Peeh. Sie ist Rosarius‘ große Liebe. Sie lernen sich als Kinder in der Zeit kennen, in der Rosarius sich der Welt nur summend mitteilt und freunden sich an, auch gegen den Willen von Peehs Mutter. Eine Zeit lang verbringen sie jeden Tag miteinander, bis Peeh wegzieht und Rosarius von Sehnsucht und Kummer geplagt wird.
Norbert Scheuer hat mit „Peehs Liebe“ einen Roman voll von nahezu zeitloser Poesie geschaffen. Ruhig, fast unberührt von äußeren Ereignissen scheint diese Geschichte aus der Eifel zu sein und auch in der Sprache findet sich diese Zeitlosigkeit wieder. In die Erzählung eingewoben finden sich zahlreiche Zitate aus Hölderlins „Hyperion“, die sich mit der Poesie von Scheuers Worten perfekt verbinden. Alles scheint in der Zeit verloren zu sein und alles dreht sich dennoch um diesen kleinen Ort Kall in der Eifel. Zugleich üben die ungewöhnlich kurzen Kapitel, die selten mehr als drei bis vier Seiten umfassen, eine unheimliche Sogwirkung aus und viel zu schnell hat man diesen kurzen, geradezu komprimierten Roman durchgelesen.
„Peehs Liebe“ ist atmosphärisch sehr dicht – durch die kunstvolle Sprache, die der Realität ein wenig entrückte Geschichte, aber auch durch die vielen Parallelgeschichten, die den Roman mit anderen Erzählungen Norbert Scheuers verbinden. So trifft man auch in diesem Roman auf Leo Arimond, den man bereits aus „Flussabwärts“ oder „Überm Rauschen“ kennt. Auch viele Orte kennt man bereits aus vorherigen Werken Scheuers, von Gaststätten, Fußballplätzen bis hin zum Supermarkt, was dazu führt, dass die Geschichte trotz ihrer traumwandlerischen Erzählweise sehr real wirkt. Von Roman zu Roman lernt man die provinzielle Abgeschiedenheit dieser Handlungsorte in der Eifel besser kennen, ohne dass sie konstruiert oder künstlich wirken.
In jedem Fall ist Kall eine Reise wert – zumindest eine Lesereise. Und „Peehs Liebe“ ist ein Roman, von dem man sich zehn Mal so viele Seiten gewünscht hätte. Mindestens.
♠ Norbert Scheuer: Peehs Liebe. C. H. Beck Verlag 2012, 222 Seiten, gebunden, 17,95 Euro. ISBN: 978-3406639494. ♠
(Auch zu Norbert Scheuer: I come from down in the valley…)
 Im Jahr 1568 entstand in den Niederlanden ein Bild des Malers Pieter Bruegel der Ältere mit dem Namen „Der Blindensturz“. Zu sehen sind sechs Männer im mittleren Lebensalter, die, allesamt in einer Menschenkette aufgereiht, sich aneinander festhalten und der Reihe nach hinzufallen drohen. Der erste Mann in der Reihe, scheinbar der Anführer, liegt schon gefallen im Bach, der zweite stürzt gerade, die anderen vier werden hinterhergezogen. Bei vier der sechs Männer sieht man es genau, bei den zwei anderen lässt es sich vermuten: Die Männer sind blind.
Im Jahr 1568 entstand in den Niederlanden ein Bild des Malers Pieter Bruegel der Ältere mit dem Namen „Der Blindensturz“. Zu sehen sind sechs Männer im mittleren Lebensalter, die, allesamt in einer Menschenkette aufgereiht, sich aneinander festhalten und der Reihe nach hinzufallen drohen. Der erste Mann in der Reihe, scheinbar der Anführer, liegt schon gefallen im Bach, der zweite stürzt gerade, die anderen vier werden hinterhergezogen. Bei vier der sechs Männer sieht man es genau, bei den zwei anderen lässt es sich vermuten: Die Männer sind blind.
Um dieses Gemälde spinnt Gert Hofmann seine wie das Bild betitelte Erzählung „Der Blindensturz“. Durchgehend in der zweiten Person Plural geschrieben, wird von der mühsamen Prozedur der blinden Männer, am Tag des Maltermins den Weg zum Haus des Künstlers zu finden und vom Malen des Bildes selbst berichtet. Dabei stellt sich eines ganz deutlich heraus: dass jene, die sich in nichts auf der Welt wirklich sicher sein können, da sie es nicht sehen, sich auch auf niemanden verlassen können. Wie in einer Irrfahrt werden die Männer von einem Ort zum nächsten geschickt, müssen sich auf die Aussagen derjenigen verlassen, auf die sie treffen, nur um doch wieder in die falsche Richtung geschickt zu werden – wegen der Gleichgültigkeit jener, die sehen können und sich nicht um das Schicksal der blinden Bettler kümmern. Wie ein willenloser Spielball gelangen sie von Person zu Person, stolpern und kriechen vorwärts in der Hoffnung, irgendwann doch noch das Haus des Malers zu erreichen.
Und dann, weil wir nicht sicher sind, ob Balthasar noch bei uns ist, rufen wir: He, Balthasar, bist du noch hier? Aber Balthasar antwortet nicht, wir sind also wohl alleine. Trotzdem immer wieder das Gefühl, dass uns einer sieht, einer, der schweigt, von schräg oben. Deshalb fassen wir uns wieder bei den Händen und rufen: He, schaut uns jemand an? Aber bis auf die Geräusche der Luft und der Erde und die, die wir selbst machen (mit unseren Herzen, unseren Lungen, unseren Kehlen, unserem Mund), ist alles still um uns.
Gert Hofmann schafft vor allem durch die Wir-Perspektive und die besonders gelungene Darstellung der Orientierungslosigkeit der Männer ein sehr eingehendes Porträt zwischenmenschlicher Beziehungen in einer Welt nahezu fehlender Nächstenliebe. „Wir“ sind im Text die zwei Männer, die stets in der Mitte der Gruppe gehen, wenn mit Stöcken und langsamem Gang versucht wird, Schritt für Schritt voranzukommen. In ihrer hoffnungslosen Lage sind die Blinden auf die Güte anderer Menschen angewiesen, die ihnen jedoch zumeist verwehrt wird. Sogar der Maler, exzentrisch und selbst schon durch Krankheit bedroht von der Blindheit, dirigiert die Blinden nur wie besessen herum, dass sie wieder und wieder die eine Szene für ihn nachstellen, sich wieder und wieder in den Bach werfen, damit er das menschliche Entsetzen und den Schrecken möglichst originalgetreu auf die Leinwand bannen kann.
„Der Blindensturz“ ist eine kurze Erzählung, gestaltet wie ein vielschichtiges Gemälde, an dem man auch nach langem Betrachten noch neue Details entdeckt; eindringlich und erschreckend, scheinbar absurd und komisch.
♠ Gert Hofmann: Der Blindensturz. dtv 1994, 136 Seiten, Taschenbuch, 6,60 Euro. ISBN: 978-3423119924 (Jahr der Erstausgabe: 1985). ♠
 Patrick ist 17 und verschwindet in den Ferien und nach der Schule für den Großteil seiner Freizeit in der virtuellen Welt eines Onlinespiels. Wie in Onlinespielen so üblich, kämpft er dort mit einem seinem Alter Ego – in diesem Fall einer Zornelfenzauberin namens Pocahonta – gegen Drachen, Dämonen und ähnliche Schergen. Seinem Vater Henner passt das gar nicht. Er hat einen regelrechten Hass auf das Spiel entwickelt, das ihm nach Henners Ansicht seinen Sohn weggenommen hat.
Patrick ist 17 und verschwindet in den Ferien und nach der Schule für den Großteil seiner Freizeit in der virtuellen Welt eines Onlinespiels. Wie in Onlinespielen so üblich, kämpft er dort mit einem seinem Alter Ego – in diesem Fall einer Zornelfenzauberin namens Pocahonta – gegen Drachen, Dämonen und ähnliche Schergen. Seinem Vater Henner passt das gar nicht. Er hat einen regelrechten Hass auf das Spiel entwickelt, das ihm nach Henners Ansicht seinen Sohn weggenommen hat.
Für Patrick ist das Spiel eine Ablenkung. Sein Charakter Pocahonta ist meist mit dem Barbaren Mr. Smith unterwegs, hinter dem sich die ebenfalls 17-jährige Spielerin Nevena aus Belgrad verbirgt. Beide schreiben viel miteinander, außerhalb des Chats haben sie sich bereits hunderte von E-Mails geschrieben. Begonnen hat dies vor knapp zwei Jahren, als Patricks Mutter Astrid im Sterben lag. Den Kampf gegen den Krebs hat Astrid irgendwann verloren – allein die Ablenkung durch das Spiel blieb für Patrick zurück.
Seitdem sie abwechselnd für die erkrankte Astrid sorgen mussten, verlief die Kommunikation zwischen Henner und Patrick nur noch zweckdienlich. Es wurde geplant, wer wann für was zu sorgen hatte und daran wurde sich gehalten. Und auch nach dem Tod der Mutter ist die Kommunikation zwischen Patrick und seinem Vater rudimentär geblieben. Patrick loggt sich ein und sein Vater Henner hasst das Spiel dafür. Aber aussprechen kann er es nicht. Stattdessen schämt Henner sich manchmal für Patrick und wünscht sich einen Sohn, der mit ihm in die Disco geht oder andere, spontane Dinge in der realen Welt unternimmt.
Vater und Sohn leben im selben Haus parallel und aneinander vorbei. Henner arbeitet in einem Museum und restauriert zu Hause alte Möbelstücke. Vor Kurzem hat er inseriert, dass er den alten Wohnwagen seiner Frau verkaufen will, und lotst gerade Kaufinteressenten durch den voll funktionstüchtigen Oldtimer, als er ein Angebot eines reichen Italieners aus Triest bekommt, eine Antiquität auf Echtheit und Wert zu prüfen. Zeitgleich verschwindet in Patricks Onlinespiel Nevena, deren Alter Ego Mr. Smith sich mitten im Kampf in Luft auflöst und nicht mehr auftaucht – tagelang. Patrick macht sich Sorgen, da Nevena noch nie ohne jede Nachricht für längere Zeit verschwunden war. Er durchstöbert ihre E-Mails auf der Suche nach persönlichen Angaben, mit denen er sie suchen kann, stellt aber fest, dass er noch nicht einmal ihren Nachnamen kennt. Zwar erzählt Nevena ständig von ihrer großen, chaotischen Familie, schreibt aber nie konkrete Namen oder Daten. Lediglich der Hinweis auf einen Kellner im kroatischen Ferienort Opatija, in dem Nevena häufig Urlaub macht, ist ein kleiner Hinweis, ein dünner Strohhalm Realität. Patrick erzählt Henner von seinen Sorgen und gemeinsam beschließen sie, nach Triest aufzubrechen, die Antiquität zu untersuchen und danach einen Umweg in das nur knapp einhundert Kilometer entfernte Opatija zu unternehmen und nach dem Verbleib von Nevena zu forschen – eine Reise, die sie im alten Wohnmobil tausende Kilometer weit und quer durch das ehemalige Jugoslawien führen wird.
Der Roman ist ein klassischer Roadtrip, der von dem Versuch erzählt, eine Verbindung zwischen der virtuellen und der realen Welt und eine Brücke zwischen Vater und Sohn herzustellen. Wer an eine künstlerische Auseinandersetzung mit der Spielsucht-Thematik denkt, liegt hier jedoch falsch. Vielmehr wird nach Antreten der Reise nach Triest und Opatija die Schilderung der aktuellen Situation der Menschen im Balkan nach den Jugoslawienkriegen in den Vordergrund gestellt, stets verknüpft mit der Suche nach Nevena und ihrer wahren Identität. Spinnens Darstellung gibt einen Einblick in die Mischung aus Aufbruchsstimmung und Frustration in den Balkanstaaten, spiegelt die Schönheit dieser Staaten ebenso wider wie die noch immer sichtbaren Folgen des Krieges durch Zerstörung, Flucht und spätere Wiedereinwanderung.
Während Henners Betrachtungen der Reise dadurch sehr authentisch wirken, werden Patricks Schilderungen, die sich in der Erzählung stetig mit Henners abwechseln, ständig durch Impressionen aus seinem Onlinespiel unterbrochen. Anfangs mag man noch denken, dass das wohl normal ist, wenn man sich vom Computer losgeeist hat und sich nun auf einer Tour quer durch Europa befindet. Unterhaltsam sind die eher ironisch überhöhten Hinweise auf das Onlinespiel, wie die „hitzeresistenten Frosthandschuhe des Winterzorns“, deren Augenzwinkern kaum zu überlesen ist. Aber irgendwann werden die stetigen Vergleiche mit dem Spiel geradezu nervtötend. Patrick denkt bei im Wind klappernden Fahnenmasten an eine geeignete Hintergrundmusik für eine Spielszene. Während er in Triest von einem Raum zum nächsten schreitet, denkt er, dass kein Levelwechsel dramatischer sein könnte. An manch einer Stelle schlägt sein Herz so schnell wie damals als er im Spiel … – und es folgt ein Vergleich mit einer Kampfszene. Natürlich hat er die Intro-Musik des Spiels als Klingelton, manchmal will er, tausende Kilometer von seinem Computer entfernt, unwillkürlich die Actiontaste drücken und die Menschen um ihn herum benehmen sich wie seine persönlichen Questgeber.
Wenn diese ständigen Anklänge an das Spiel den Gamer Patrick realistischer erscheinen lassen sollen, so klappt das nicht ganz. An vollkommen unerwarteten Stellen bricht Patrick plötzlich aus dem „real life“ aus und kommt mit einem Spielvergleich daher und spannende oder stimmige Handlungsverläufe werden dadurch in abstruser Weise unterbrochen. Da hilft es auch nicht viel, wenn man erst im Nachsatz zum Roman Spinnens Anmerkung liest, dass er „die Erscheinungsform und die ‚Grammatik‘ des Spiels den Erfordernissen der Geschichte angepasst“ hat.
Dementsprechend ist „Nevena“ durch die Thematisierung des Balkans interessant, steht sich an vielen Stellen durch den Handlungsstrang „Onlinespiel“ aber selbst im Weg. Wahrscheinlich ist es für Leser, die mit Onlinespielen nichts oder nicht viel anfangen können, umso interessanter, aber selbst für Casual-Gamer sei hier Vorsicht vor gelegentlichem facepalm geboten. Zwinkersmily.
♠ Burkhard Spinnen: Nevena. Schöffling & Co. 2012, 320 Seiten, gebunden, 19,95 Euro. ISBN: 978-3895610448 ♠
 Mit dem Nötigsten auskommen zu müssen – das prophezeit sich Elisabeth, genannt Lisa, bereits nach den ersten Tagen in Kanada. Sie ist 16 und gerade im frostigen Territorium von Yukon angekommen, wo das Thermometer nur selten positive Zahlen schreibt. Aus dem Nest ihrer gut situierten und christlich-religiös geprägten Familie geradezu entflohen, versucht Lisa nach anfänglicher Orientierungslosigkeit im fremden Land Anschluss zu finden. Für ein paar Tage wohnt sie bei ihrer Schwester, die mit ihrem Mann in Kanada lebt, zieht dann in die Wohnung einer neugierigen, missmutigen Vermieterin, von der sie recht bald wieder vor die Tür gesetzt wird.
Mit dem Nötigsten auskommen zu müssen – das prophezeit sich Elisabeth, genannt Lisa, bereits nach den ersten Tagen in Kanada. Sie ist 16 und gerade im frostigen Territorium von Yukon angekommen, wo das Thermometer nur selten positive Zahlen schreibt. Aus dem Nest ihrer gut situierten und christlich-religiös geprägten Familie geradezu entflohen, versucht Lisa nach anfänglicher Orientierungslosigkeit im fremden Land Anschluss zu finden. Für ein paar Tage wohnt sie bei ihrer Schwester, die mit ihrem Mann in Kanada lebt, zieht dann in die Wohnung einer neugierigen, missmutigen Vermieterin, von der sie recht bald wieder vor die Tür gesetzt wird.
Woran orientieren, in einem fremden Land? Die Schwester lebt knapp 120 Kilometer entfernt von Lisas Highschool- und Wohnort und scheidet als unterstützende oder kontrollierende Instanz aus. Nur an Sonntagen teilen sich die beiden den Gang zum Gottesdienst, der Lisa ein zunehmend schlechtes Gewissen beschert. Sie klinkt sich in die Gemeinschaft ihrer Mitschüler ein, will dazugehören. Feucht-fröhliche Partys bescheren ihr eher zufällig den Ruf, trinken zu können wie ein Seemann, mitsamt dem Kosenamen „german sailor“. Nach ihrem Rauswurf aus der Wohnung zieht Lisa zusammen mit mehreren anderen in eine mintgrüne Reihenhaushälfte. Zu Alkohol und Zigaretten mischen sich recht schnell Drogen und Fehlstunden an der Highschool. Lisa will sich beweisen, will anerkannt werden. Mit dem Geld, das ihre Familie ihr schickt, bezahlt sie die Miete für die zur Party-Hochburg und Messi-WG verkommenden Wohnung. Sie geht kaum noch zur Schule, trinkt – und verliebt sich. Immer weiter klafft der Graben zwischen den Mahnreden von Pastor Leroy und den filmrissigen Partys. Predigttexte vermischen sich mit Rocksongs, bis eines Tages eine alkoholgetränkte Feier eine tiefe Kerbe in Lisas Leben schlägt. Der Konflikt zwischen der Reinheit der religiösen Erziehung und ihren Erlebnissen steigert sich für Lisa bis in eine existenzielle Zerreißprobe.
Und hinter allem steht – zehn Jahre später – Lisa, die in der Rückschau versucht, ihre chaotische, in Nebel gehüllte Zeit in Kanada zu ordnen und von sich zu schreiben. Sie will etwas loswerden, das an dieser Zeit haftet, das vergessen werden will, aber nicht vergessen werden kann. Sie schafft ein Mosaik aus kanadischen Versatzstücken, eine Montage, die die Puzzleteile zu einem unvollständigen Bild zusammenfügt, einen Lückentext, der die verdrängten Leerstellen der Vergangenheit widerwillig auszufüllen sucht.
Dass die Autorin Lisa Kränzler bildende Künstlerin ist und Malerei studiert hat, spiegelt sich auch in ihrer Sprache wider. Insbesondere die Farben – in den Schnee-Ebenen von Kanada hauptsächlich blasse, weiße, graue und dreckige Töne – sind überaus präsent, zudem das Aufsprengen von gewohnten Bildern in bruchstückhafte, mikroskopische Detailaufnahmen, in Partikel, die sich wiederum zu einem kunstvollen, großen Ganzen verketten. Oftmals ist unklar, ob die gerade beschriebenen Vorkommnisse wirklich geschehen oder nur Auswuchs einer Drogeneskapade sind. Und in all dem rauen, oft ungeschmückten Tonfall gibt es einige Stellen von kunstvoll stilsicherer Sprachschönheit.
„Export A“ ist ein beachtlicher Debütroman über unbedachte Konsequenzen, über das versuchte Austreiben der eigenen Dämonen durch das Schreiben, über Verantwortung, Schuld und Sünde.
♠ Lisa Kränzler: Export A. Verbrecher Verlag 2012, 265 Seiten, gebunden, 21,00 Euro. ISBN: 978-3943167030. ♠