
Mein Urahn Ambrosius Arimond glaubte, alle Vögel unserer Erde besäßen eine gemeinsame Sprache. Sein Leben lang beschäftigte er sich mit der Entschlüsselung ihrer Gesänge, einer Welt magisch klingender Töne, Zeichen und Bedeutungen.
Wir schreiben das Jahr 2003 und Paul Arimond kommt 23-jährig nach Afghanistan, weil er sich bei der Bundeswehr freiwillig für den Sanitätsdienst gemeldet hat. Von klein auf ist Paul fasziniert von der Ornithologie, hat früher zusammen mit seinem Vater viele Ausflüge unternommen und stundenlang Vögel beobachtet – eine Tradition, die in der Familie Arimond bereits spätestens im 18. Jahrhundert ihren Ursprung nimmt. Denn in den Achtzigerjahren des 18. Jahrhunderts zog es Pauls Vorfahren Ambrosius nach Süd- und Zentralasien, um dort die Ländereien zu erkunden und ihm unbekannte Vogelarten zu entdecken und zu studieren. Dieser Leidenschaft geht Ambrosius auf seinen ausgedehnten Reisen durch den Mittleren Osten jahrelang nach und Paul, sein Nachkomme, führt die Beobachtungen über 200 Jahre später fort.
An vielen Stellen im Roman werden Pauls ornithologische Beobachtungen von Zeichnungen der beschriebenen Vögel unterstützt, von Aquarellen, die Paul mit starkem Kaffee auf Papier malt. Sie lassen den Leser innehalten und selbst zum Betrachter der Vögel werden und erinnern gleichzeitig an die Anfänge der Vogelkunde und damit wiederum an Pauls Vorfahren Ambrosius. Seine Reise stellt den scharfen Kontrast zu Pauls Stationierung in Afghanistan dar: Ambrosius’ Reiseberichte spiegeln eine idyllisch-verklärte Entdeckerstimmung, beschreiben eine idealisierte, längst vergangene Kultur, in der von Krieg keine Rede ist – der Name „Ambrosius“ steht fast symbolhaft für das Paradies auf Erden, das Pauls Urahn in der Ferne vorfindet. Paul hingegen findet sich in einem völlig anderen, zerstörten Afghanistan wieder und versucht trotz aller Widrigkeiten, in der Vogelbeobachtung die heile Welt seines Vorfahren zu finden.
Schnell wird deutlich, dass die Vogelbeobachtungen für Paul ein Weg sind, mit dem Kriegsgeschehen vor Ort zurechtzukommen. Sie nehmen den Hauptteil seiner Berichte ein, der Krieg wird oft gar nicht oder nur nebenher erwähnt, als würde er von Beginn an verdrängt werden. Doch nach und nach schleicht der Krieg sich ein in Pauls Berichte und je bedrohlicher die Situation in seinem Lager wird, desto verzweifelter versucht Paul, sich in die Beobachtungen der afghanischen Tierwelt zu flüchten, ist die Tierwelt doch neutrale Instanz im Kriegsgeschehen rund um ihn herum.
Vielleicht kommt es im Leben nur darauf an, irgendetwas zu finden, bei dem alles andere in Vergessenheit gerät.
In klarer, ausdrucksstarker Sprache verwebt Norbert Scheuer die beiden so konträren Themenbereiche Krieg und Ornithologie im Verlauf des Romans immer enger. Zwischendurch wechselt ab und an die Perspektive und es werden in Rück- und Vorgriffen immer neue Versatzstücke aus Pauls Lebensgeschichte eingestreut, deren Puzzleteile sich so nach und nach zu einer weiteren Geschichte von Flucht und Verdrängung zusammensetzen. Der Roman tastet sich auf diese Weise an das große Thema der Traumata heran, beschreibt feinsinnig die Auswirkungen von Krieg und Verdrängung auf die menschliche Psyche und hüllt die Rahmenhandlung in einen für Paul schützenden Mantel aus naturkundlichen Beschreibungen. Aber der Roman macht auch von Anfang an deutlich, dass die titelgebende „Sprache der Vögel“ ein zweischneidiges Schwert ist: Für Ambrosius sprechen die Vögel der Erde eine universale Sprache, die es zu entziffern gilt, die die Vögel auf ihren unsichtbaren Bahnen mit sich durch die Lüfte tragen. Für Paul werden die Stimmen der Vögel hingegen mehr und mehr Ausdruck einer inneren Zerreißprobe:
Ich höre wieder unbekannte, wohlklingende Vogelstimmen im Traum, aber ich fürchte, irgendwann wird sich das ändern und ich werde schreiend aufwachen.
Die Zuspitzung von Pauls innerem Kampf inmitten von Krieg und unbewältigter Vergangenheit stellt Norbert Scheuer grandios dar. Ein starker, lesenswerter Roman.
♠ Norbert Scheuer: Die Sprache der Vögel. C.H.Beck 2015, 238 Seiten, gebunden, 19,95 Euro. ISBN: 978-3406677458. ♠


 Die altbekannte Schullektüre: Michael Kohlhaas, ein brandenburgischer Pferdehändler des 16. Jahrhunderts, reist nach Sachsen, um dort seine Pferde zu verkaufen. An der Landesgrenze angelangt, wird er von einem Schlagbaum und einem Wärter an der Weiterreise gehindert. Man erklärt ihm, dass der alte Landesherr gestorben sei und er, Kohlhaas, für die Weiterreise einen Pass benötige. Da er aber keinen Pass besitzt, ringt man ihm als Pfand zwei seiner Pferde ab, die er, sobald er mit dem entsprechenden Pass aus Dresden zurückkehrt, wiederbekommen kann. Kohlhaas lässt einen seiner Knechte mit den beiden Pferden zurück und kehrt nach einigen Wochen, in denen er ein ertragreiches Geschäft in Dresden gemacht hat, zur Grenze zurück.
Die altbekannte Schullektüre: Michael Kohlhaas, ein brandenburgischer Pferdehändler des 16. Jahrhunderts, reist nach Sachsen, um dort seine Pferde zu verkaufen. An der Landesgrenze angelangt, wird er von einem Schlagbaum und einem Wärter an der Weiterreise gehindert. Man erklärt ihm, dass der alte Landesherr gestorben sei und er, Kohlhaas, für die Weiterreise einen Pass benötige. Da er aber keinen Pass besitzt, ringt man ihm als Pfand zwei seiner Pferde ab, die er, sobald er mit dem entsprechenden Pass aus Dresden zurückkehrt, wiederbekommen kann. Kohlhaas lässt einen seiner Knechte mit den beiden Pferden zurück und kehrt nach einigen Wochen, in denen er ein ertragreiches Geschäft in Dresden gemacht hat, zur Grenze zurück. Da sitzt ein Mensch vor ihm, dem namenlosen Protagonisten, und der Protagonist taxiert das Äußere, das Gesicht, kann Alter und Geschlecht zuordnen – aber sonst nichts. Dennoch weiß er, dass dies sein Vater ist – nicht, weil er ihn erkennt, sondern weil er in der Wohnung des Vaters ist. Das liegt nicht etwa daran, dass sie sich schon eine ganze Weile nicht gesehen haben, sondern daran, dass er, der Protagonist, sich keine Gesichter merken kann, weil er bei seiner Geburt zu wenig Luft bekam und ihm so ein Teil des visuellen Erinnerungsvermögens fehlt. So muss er alle Menschen immer wieder neu kennenlernen bis es sich ihm aus dem Kontext erschließt, wer sie sind, bis sie ihm eröffnen, wer sie sind oder bis er seinen Stolz überwindet und nachfragt – was bei Personen, die von seinem fehlenden Erinnerungsvermögen nicht wissen, zu Belustigung, Irritation oder Verärgerung führen kann.
Da sitzt ein Mensch vor ihm, dem namenlosen Protagonisten, und der Protagonist taxiert das Äußere, das Gesicht, kann Alter und Geschlecht zuordnen – aber sonst nichts. Dennoch weiß er, dass dies sein Vater ist – nicht, weil er ihn erkennt, sondern weil er in der Wohnung des Vaters ist. Das liegt nicht etwa daran, dass sie sich schon eine ganze Weile nicht gesehen haben, sondern daran, dass er, der Protagonist, sich keine Gesichter merken kann, weil er bei seiner Geburt zu wenig Luft bekam und ihm so ein Teil des visuellen Erinnerungsvermögens fehlt. So muss er alle Menschen immer wieder neu kennenlernen bis es sich ihm aus dem Kontext erschließt, wer sie sind, bis sie ihm eröffnen, wer sie sind oder bis er seinen Stolz überwindet und nachfragt – was bei Personen, die von seinem fehlenden Erinnerungsvermögen nicht wissen, zu Belustigung, Irritation oder Verärgerung führen kann. Ein Mann blickt zurück auf seinen finanziellen wie emotionalen Ruin: Nicht nur wurde Christian Eschenbach (im Roman meist nur bei seinem Nachnamen genannt) von seiner Geliebten verlassen, auch seine eigentlich gut laufende Software-Firma muss durch eine Verkettung unglücklicher Umstände Konkurs anmelden. Sechs Jahre ist dies nun her, doch Eschenbach scheint die Ereignisse kaum verarbeitet zu haben. Er kapselt sich ab und nimmt das Angebot eines Freundes, auf der Nordseeinsel Scharhörn für einige Monate als Vogelwart zu arbeiten, nur zu gern an.
Ein Mann blickt zurück auf seinen finanziellen wie emotionalen Ruin: Nicht nur wurde Christian Eschenbach (im Roman meist nur bei seinem Nachnamen genannt) von seiner Geliebten verlassen, auch seine eigentlich gut laufende Software-Firma muss durch eine Verkettung unglücklicher Umstände Konkurs anmelden. Sechs Jahre ist dies nun her, doch Eschenbach scheint die Ereignisse kaum verarbeitet zu haben. Er kapselt sich ab und nimmt das Angebot eines Freundes, auf der Nordseeinsel Scharhörn für einige Monate als Vogelwart zu arbeiten, nur zu gern an.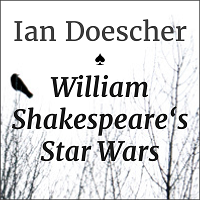 Das Werk, um das es hier nun geht, ist
Das Werk, um das es hier nun geht, ist Krissie Donald ist das, was sie selbst als gescheiterte Existenz bezeichnen würde: Sie ist Mutter wider Willen und kommt, auch wenn sie selbst beruflich als Sozialarbeiterin verwahrloste Kinder vor ihren Eltern schützt, nicht im Geringsten mit der eigenen Verantwortung klar. Sie wandelt von einer Bettgeschichte zur nächsten, ist nicht fähig, sich dauerhaft zu binden – sucht vielleicht, findet aber nichts, was dem Glück auch nur annähernd ähnelt. Auch ihr Kind entstand in einer drogengeschwängerten Nacht im Urlaub auf Teneriffa, ist vaterlos und überfordert sie. Um auszuspannen und den Kopf wieder frei zu bekommen fährt Krissie mit ihrer besten Freundin Sarah und deren Ehemann Kyle in die schottischen Highlands.
Krissie Donald ist das, was sie selbst als gescheiterte Existenz bezeichnen würde: Sie ist Mutter wider Willen und kommt, auch wenn sie selbst beruflich als Sozialarbeiterin verwahrloste Kinder vor ihren Eltern schützt, nicht im Geringsten mit der eigenen Verantwortung klar. Sie wandelt von einer Bettgeschichte zur nächsten, ist nicht fähig, sich dauerhaft zu binden – sucht vielleicht, findet aber nichts, was dem Glück auch nur annähernd ähnelt. Auch ihr Kind entstand in einer drogengeschwängerten Nacht im Urlaub auf Teneriffa, ist vaterlos und überfordert sie. Um auszuspannen und den Kopf wieder frei zu bekommen fährt Krissie mit ihrer besten Freundin Sarah und deren Ehemann Kyle in die schottischen Highlands.
 It could be anyone. Und weil dem so ist, heißen die beiden Protagonistinnen des Romans „Nachhinein“ JasmineCelineJustine und LottaLuisaLuzia. Austauschbar ähnliche Dreifachnamen, die, so wahllos sie auch wirken, aber schon auf den sozialen Hintergrund der beiden hindeuten könnten: Während LottaLuisaLuzia Kind gut situierter Akademiker ist, sind JasminCelineJustines Familienverhältnisse gelinde gesagt zerrüttet. Doch die beiden Mädchen sind beste Freundinnen, verbringen den Großteil ihrer ihre Freizeit miteinander, schließen Blutsschwesternschaft. Sie gehen zusammen in den Kindergarten und in die Grundschule, verbringen ihre Nachmittage zusammen, werden älter und üben sich in kindlich-spielerischem Näherkommen und Eifersucht – bis sich plötzlich ein Riss durch das Bild zieht. Aber lange scheint dieser Riss nur für JasminCelineJustine sichtbar. Ihr Leben wird auf den Kopf gestellt, ihre Kindheit wird abrupt beendet und sie flüchtet sich in die Parallelwelt ihres Super Nintendo, während LottaLuisaLuzia Klavier spielt oder mit ihren Eltern in den Urlaub fährt.
It could be anyone. Und weil dem so ist, heißen die beiden Protagonistinnen des Romans „Nachhinein“ JasmineCelineJustine und LottaLuisaLuzia. Austauschbar ähnliche Dreifachnamen, die, so wahllos sie auch wirken, aber schon auf den sozialen Hintergrund der beiden hindeuten könnten: Während LottaLuisaLuzia Kind gut situierter Akademiker ist, sind JasminCelineJustines Familienverhältnisse gelinde gesagt zerrüttet. Doch die beiden Mädchen sind beste Freundinnen, verbringen den Großteil ihrer ihre Freizeit miteinander, schließen Blutsschwesternschaft. Sie gehen zusammen in den Kindergarten und in die Grundschule, verbringen ihre Nachmittage zusammen, werden älter und üben sich in kindlich-spielerischem Näherkommen und Eifersucht – bis sich plötzlich ein Riss durch das Bild zieht. Aber lange scheint dieser Riss nur für JasminCelineJustine sichtbar. Ihr Leben wird auf den Kopf gestellt, ihre Kindheit wird abrupt beendet und sie flüchtet sich in die Parallelwelt ihres Super Nintendo, während LottaLuisaLuzia Klavier spielt oder mit ihren Eltern in den Urlaub fährt. Wer frühzeitig aus dem Leben scheiden möchte, sollte dies nicht mit dem absichtlichen Verschlucken einer, mehrerer oder gar dutzender Stecknadeln forcieren. Denn abgesehen davon, dass es gegebenenfalls zu Unterleibsschmerzen kommen kann, könnte es erstens durchaus passieren, dass der behandelnde Arzt den Lebensmüden für einen Betrüger hält und daher einsperrt, um zu überwachen, ob man wirklich Stecknadeln verzehrt hat, und zweitens könnte es dazu führen, dass der interessierte, behandelnde Mediziner, sobald er von der Wahrhaftigkeit der außergewöhnlichen Nahrung überzeugt wurde, damit beginnt, ein auf die Nadel genaues Protokoll der Ausscheidungen derselbigen anzulegen – und sich um den sonstigen Geisteszustand des Patienten wenig zu scheren.
Wer frühzeitig aus dem Leben scheiden möchte, sollte dies nicht mit dem absichtlichen Verschlucken einer, mehrerer oder gar dutzender Stecknadeln forcieren. Denn abgesehen davon, dass es gegebenenfalls zu Unterleibsschmerzen kommen kann, könnte es erstens durchaus passieren, dass der behandelnde Arzt den Lebensmüden für einen Betrüger hält und daher einsperrt, um zu überwachen, ob man wirklich Stecknadeln verzehrt hat, und zweitens könnte es dazu führen, dass der interessierte, behandelnde Mediziner, sobald er von der Wahrhaftigkeit der außergewöhnlichen Nahrung überzeugt wurde, damit beginnt, ein auf die Nadel genaues Protokoll der Ausscheidungen derselbigen anzulegen – und sich um den sonstigen Geisteszustand des Patienten wenig zu scheren.