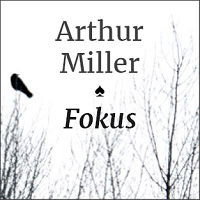 In einer ungewöhnlich heißen Sommernacht Mitte der Vierzigerjahre wird Lawrence Newman von einer Stimme aus dem Schlaf gerissen. Eine Frau – Newman vermutet anhand des Akzents eine Puerto-Ricanerin – wird vor seinem Haus von jemandem bedrängt und ruft um Hilfe, ruft nach der Polizei. Newman beobachtet die Szene. Schweigt. Schließt das Fenster und wartet ab, bis es draußen wieder ruhig ist, um sich dann müde und desinteressiert wieder ins Bett zu legen. Was geht ihn das Unglück anderer an:
In einer ungewöhnlich heißen Sommernacht Mitte der Vierzigerjahre wird Lawrence Newman von einer Stimme aus dem Schlaf gerissen. Eine Frau – Newman vermutet anhand des Akzents eine Puerto-Ricanerin – wird vor seinem Haus von jemandem bedrängt und ruft um Hilfe, ruft nach der Polizei. Newman beobachtet die Szene. Schweigt. Schließt das Fenster und wartet ab, bis es draußen wieder ruhig ist, um sich dann müde und desinteressiert wieder ins Bett zu legen. Was geht ihn das Unglück anderer an:
Ihre Aussprache war für Newman ein Beweis, dass sie zu keinem guten Zweck bei Nacht unterwegs war, außerdem gab sie ihm die Überzeugung, dass sie selber auf sich Acht geben konnte, da sie ja an diese Art Behandlung gewöhnt sein musste. Die Leute aus Puerto Rico waren so etwas gewohnt, das wusste er.
New York, kurz vor Ende des Zweiten Weltkriegs. Lawrence Newman, im medizinischen wie im übertragenen Sinne stark kurzsichtig, liebt es gern gleichgeschaltet und ordentlich. Und Lawrence Newman ist ein waschechter Rassist. Er sitzt gern in der U-Bahn und sortiert Menschen ihrem Aussehen nach unterschiedlichen Ethnien, Nationalitäten und Religionszugehörigkeiten zu. Er ist stolz auf seine genaue Wahrnehmung und sein Können, Kopfformen, Augengrößen, Hautfarben und so weiter miteinander kombinieren und die Menschen so auf Anhieb in die Schubladen einsortieren zu können, in die sie gehören. Hauptsache, er muss nichts mit ihnen zu tun haben. Was sollte er auch mit „solchen Leuten“ anfangen.
Mit dieser Ansicht ist Newman in seiner Straße in bester Gesellschaft. Seine Nachbarn und Freunde sind ebenfalls penibel darauf bedacht, insbesondere alles Jüdische zu meiden und zu diskreditieren, was vor allem der jüdische Süßwaren- und Zeitungsverkäufer der Straße deutlich zu spüren bekommt. Jüdische Nachbarn werden wie Invasoren behandelt, werden von der sauberen, christlichen, ja arischen Nachbarschaft verächtlich und herablassend behandelt. Und Newman fühlt sich als Arier hier ganz zu Hause – bis zu dem Tag, an dem er auf der Arbeit von seinem Vorgesetzten dazu verdonnert wird, sich endlich eine Brille gegen seine immer stärker werdende Sehschwäche anzuschaffen. Newman hat schon seit Wochen mit sich gehadert, hat Kontaktlinsen ausprobiert, verträgt diese aber nicht, hat eine Brille bestellt, diese aber nie abgeholt; nun aber führt kein Weg mehr daran vorbei: Newman muss eine Brille tragen. Notgedrungen holt Newman seine Brille ab, stolpert nach Hause und setzt sie im heimischen Badezimmer widerwillig auf. Kurz müssen sich seine Augen anpassen, dann aber ist er überaus fasziniert davon, wie klar er seine Umgebung wahrnimmt – selbst die Borsten seiner Zahnbürste sieht er so gestochen scharf wie nie zuvor. Doch dann folgt ein Blick in den Spiegel.
Lange stand er da und starrte auf sein Spiegelbild; auf seine Stirn, sein Kinn, seine Nase. […] Im Spiegel seines Badezimmers, des Badezimmers, das er seit fast sieben Jahren benützte, sah er ein Gesicht, das nicht ohne Berechtigung für das Gesicht eines Juden gehalten werden musste.
Darum hatte Newman sich so lange dagegen gewehrt, die Brille abzuholen, aufzusetzen, auszuprobieren; die Brille steckt Newman, den heimlichen Rassensotierer, in eine Schublade, in die er nicht gehört und schon gar nicht gehören will. Und nicht nur er ist irritiert:
Nach einer Weile rief die Mutter seinen Namen. Er blickte von der Zeitung auf und wandte ihr langsam sein Gesicht zu. Sie musterte es neugierig, wobei sie sich immer weiter vorbeugte. Er lächelte leichthin, als handelte es sich um einen neugekauften Anzug.
‚Mein Gott‘, sagte sie schließlich lachend, ‚du siehst beinahe aus wie ein Jude.‘
Er lachte auch, wobei er das Gefühl hatte, als stünden seine Zähne hervor.
Aber immerhin, die Mutter winkt ab und meint: „Ich denke nicht, dass jemand es bemerken wird.“
Von wegen. Vom nächsten Tag an ist für Newman alles verändert. Misstrauisch wird er von seinen Kollegen, seinen Vorgesetzten, seinen Mitbürgern gemustert – mit der Brille kommt eine Etikettierung, gegen die Newman sich kaum wehren kann. Das Unternehmen, in dem er bisher den Stenotypistinnen vorstand, sägt ihn ab und Newman ist plötzlich mit Arbeitslosigkeit konfrontiert. Denn mit jüdisch aussehenden Personen auf repräsentativen Posten will die Firma nichts zu tun haben. Newmans einziger Rettungsanker ist die Freundschaft zu seinen rassistischen Nachbarn Fred und Carlson, die sich in der antisemitischen „Christlichen Front“ organisieren. Doch wie weit kann die Solidarität der Nachbarn mit dem eigentlich ja „arischen“ Newman denn gehen, wenn er doch so jüdisch aussieht?
Es dauert lange, bis in der Verunsicherung, in die Newman getrieben wird, Einsichten oder gar Reuegefühle zutage treten. Zu sehr klammert er sich an das Wohlbekannte seiner bisherigen Welt fest, will den festen Gefügen seiner Nachbarschaft angehören, auch wenn diese ihn mehr und mehr ausschließt. Krampfhaft versucht er, Mitläufer zu sein, wird aber nicht länger akzeptiert.
Arthur Miller dokumentiert in seinem 1945 erschienenen, einzigen Roman „Fokus“ eine erschreckend offen antisemitische US-amerikanischen Gesellschaft in den Vierzigerjahren. Ausgrenzung und Erniedrigung Außenstehender und offener Rassismus gegenüber allem Jüdischen stehen an der Tagesordnung. Damit einher geht die stets präsente Angst vor der Arbeitslosigkeit nach dem bevorstehenden Ende des Zweiten Weltkriegs und der damit mit Sicherheit einhergehenden Depression. In der sauberen, christlichen Gemeinschaft will man andere im Dreck sehen, um sich selbst besser fühlen zu können. Und die jüdischen Mitbürger bieten hier das perfekte Feindbild, gegen das sich überall im Land Gruppen von Aktivisten gründen – während die Polizei wegschaut.
„Die Polizei weiß, was vorgeht. Es gibt kein Gesetz, das es Menschen verbietet, einander zu hassen.“
„Ich kann bis heute nicht in diesem Roman blättern, ohne erneut die Dringlichkeit zu empfinden, die das Schreiben begleitete“, schrieb Arthur Miller 1984, knapp vierzig Jahre später. „Damals war der Antisemitismus in Amerika meines Wissens literarisch ein wenn nicht tabuisiertes, so doch totgeschwiegenes Thema.“ Und obwohl mittlerweile bereits über siebzig Jahre alt, ist der Roman auch heute noch aktueller denn je. Er ist Spiegelbild einer Gesellschaft von Duckmäusern, von Mitläufern und jenen, die alle Realitäten so filtern, dass sie nur ihre Klischees und ihre vorgefertigte Meinung bestätigt sehen. „Fokus“ seziert die, auch fernab der Südstaaten, zutiefst rassistisch verblendete US-amerikanische Gesellschaft der Kriegszeit. Aber nicht minder hält der Roman auch anderen Gesellschaften, nicht zuletzt der deutschen, den Spiegel vor, bezogen auf die ewige Abgrenzung vor allem Fremden – früher wie heute. Ein Sinnbild, das leider vermutlich auch in Jahrzehnten noch aktuell sein wird, ist doch so viel einfacher, ein vorgefertigtes Bild zu haben, als sich mit dem Fremden auseinandersetzen zu müssen. Denn, so konstatiert Arthur Miller im Vorwort: „In den Spiegel der Realität zu schauen, die unschöne Welt und sich selbst zu erkennen, ist wenig erhebend und erfordert Charakter.“
Wer will das schon. Wer macht sich dafür schon die Mühe.
♠ Arthur Miller: Fokus ist im November 2017 in einer, mit 20 farbigen Holzschnitten von Franziska Neubert illustrierten Ausgabe bei der Büchergilde Gutenberg erschienen (gebunden, mit Lesebändchen, ISBN 978-3864060823, 24,- Euro). Unter der ISBN 978-3596905935 ist der Roman 2015 als Taschenbuch bei Fischer Klassik erschienen, 224 Seiten, 9,99 Euro. ♠

 Kall in der Eifel, im Jahr 2006: Eine Kleinstadt im Aufruhr – wie elektrisiert: Der Stausee in der Stadt soll vergrößert und ausgebaut werden, soll die Attraktivität des heruntergewirtschafteten Ortes wieder steigern und durch einen Ferienpark Touristen und Wohlstand anziehen. Die Bevölkerung zerteilt sich in zwei Lager von Befürwortern und Gegnern des Projekts. Die „Grauköpfe“, eine eingeschworene Gruppe alternder Männer in Kall, gehören klar zu den Befürwortern. Die Gruppe trifft sich tagtäglich in der Cafeteria des Supermarkts in Kall, um die neuesten Entwicklungen in dem Ort zu besprechen. Nichts entgeht dem tratschenden Gespann, nicht nur bezogen auf die Details zum Stausee, sondern generell: Jede Person, die die Cafeteria betritt, wird eingehend begutachtet und tuschelnd kommentiert, jedes Detail über den See und der neuste Kaller Klatsch und Tratsch landet in der Cafeteria auf dem Tisch der Grauköpfe.
Kall in der Eifel, im Jahr 2006: Eine Kleinstadt im Aufruhr – wie elektrisiert: Der Stausee in der Stadt soll vergrößert und ausgebaut werden, soll die Attraktivität des heruntergewirtschafteten Ortes wieder steigern und durch einen Ferienpark Touristen und Wohlstand anziehen. Die Bevölkerung zerteilt sich in zwei Lager von Befürwortern und Gegnern des Projekts. Die „Grauköpfe“, eine eingeschworene Gruppe alternder Männer in Kall, gehören klar zu den Befürwortern. Die Gruppe trifft sich tagtäglich in der Cafeteria des Supermarkts in Kall, um die neuesten Entwicklungen in dem Ort zu besprechen. Nichts entgeht dem tratschenden Gespann, nicht nur bezogen auf die Details zum Stausee, sondern generell: Jede Person, die die Cafeteria betritt, wird eingehend begutachtet und tuschelnd kommentiert, jedes Detail über den See und der neuste Kaller Klatsch und Tratsch landet in der Cafeteria auf dem Tisch der Grauköpfe. Was ein Buch – was ein Jahr. Rainer Maria Rilke hat Schnupfen, Thomas Mann ärgert sich über Sitzfalten am Anzug und Franz Kafka erprobt das schriftliche Stammeln. Wir sind im Jahr 1913, im Buch „1913“, in dem Florian Illies das Jahr vor dem Ausbruch des 1. Weltkriegs abbildet, unterteilt in die zwölf Monate des Kalenders.
Was ein Buch – was ein Jahr. Rainer Maria Rilke hat Schnupfen, Thomas Mann ärgert sich über Sitzfalten am Anzug und Franz Kafka erprobt das schriftliche Stammeln. Wir sind im Jahr 1913, im Buch „1913“, in dem Florian Illies das Jahr vor dem Ausbruch des 1. Weltkriegs abbildet, unterteilt in die zwölf Monate des Kalenders. Auf zwei etwas abgeschieden liegenden Höfen in der wohl polnischen Provinz wird eine Familie Opfer der Pogrome des Zweiten Weltkriegs. Sie erlebt, wie sich die ehemaligen Nachbarn und Freunde der Familie gegen sie wenden, wie ein Misstrauen, das seit längerem schon gewachsen ist, umschlägt in blinden Hass und in Gewalt, sobald die politischen Rahmenbedingungen dies möglich machen.
Auf zwei etwas abgeschieden liegenden Höfen in der wohl polnischen Provinz wird eine Familie Opfer der Pogrome des Zweiten Weltkriegs. Sie erlebt, wie sich die ehemaligen Nachbarn und Freunde der Familie gegen sie wenden, wie ein Misstrauen, das seit längerem schon gewachsen ist, umschlägt in blinden Hass und in Gewalt, sobald die politischen Rahmenbedingungen dies möglich machen. Sie ist schon eine besondere Person, die Baba Dunja. Selbstdiszipliniert und genügsam, ein wenig streng, aber dennoch gutmütig, lebt sie in einem Ort ohne Zukunft: in Tschernowo. Nachdem vor dreißig Jahren eine Reaktorkatastrophe das Land verseuchte, floh Baba Dunja gezwungenermaßen in die nächstgrößere Stadt, hielt es dort aber nicht allzu lange aus. Seit knappen 18 Jahren ist sie zurück in der Todeszone, ignoriert sämtliche Warnungen und Bitten ihrer nach Deutschland ausgewanderten Tochter, sie möge doch aus dem verstrahlten Gebiet wegziehen, und führt in der Abgeschiedenheit Tschernowos ein ruhiges, geradezu aus der Zeit gefallenes Leben. Sie ist zufrieden damit und genügsam mit dem wenigen, das sie hat. Hauptsächlich versorgt sie sich aus dem eigenen Garten, nur alle paar Wochen oder Monate, wenn es gar nicht anders geht, nimmt die über 80-Jährige die stundenlange Reise in die nächstgelegene Stadt auf sich, um notwendige Besorgungen zu machen. Baba Dunja mag diese Ausflüge nicht im Geringsten. Nur im von der Außenwelt abgeschotteten Tschernowo fühlt sie zu Hause, fühlt sie sich glücklich.
Sie ist schon eine besondere Person, die Baba Dunja. Selbstdiszipliniert und genügsam, ein wenig streng, aber dennoch gutmütig, lebt sie in einem Ort ohne Zukunft: in Tschernowo. Nachdem vor dreißig Jahren eine Reaktorkatastrophe das Land verseuchte, floh Baba Dunja gezwungenermaßen in die nächstgrößere Stadt, hielt es dort aber nicht allzu lange aus. Seit knappen 18 Jahren ist sie zurück in der Todeszone, ignoriert sämtliche Warnungen und Bitten ihrer nach Deutschland ausgewanderten Tochter, sie möge doch aus dem verstrahlten Gebiet wegziehen, und führt in der Abgeschiedenheit Tschernowos ein ruhiges, geradezu aus der Zeit gefallenes Leben. Sie ist zufrieden damit und genügsam mit dem wenigen, das sie hat. Hauptsächlich versorgt sie sich aus dem eigenen Garten, nur alle paar Wochen oder Monate, wenn es gar nicht anders geht, nimmt die über 80-Jährige die stundenlange Reise in die nächstgelegene Stadt auf sich, um notwendige Besorgungen zu machen. Baba Dunja mag diese Ausflüge nicht im Geringsten. Nur im von der Außenwelt abgeschotteten Tschernowo fühlt sie zu Hause, fühlt sie sich glücklich. Nicht selten bringen einen Bücher um den Schlaf, brennt die Leselampe länger als eigentlich geplant, wacht man morgens auf, ärgert sich über die kurze Nacht und freut sich dennoch gleichzeitig über das Gelesene. Und: Manche Bücher sind heimtückisch. Sie haben beispielsweise einen Autor, dessen Name allein bereits Gutes verheißt und der wegen seiner famosen Texte große Erwartungen weckt. Sie sehen ganz unscheinbar aus, der Klappentext verrät nicht allzu viel und der Titel wirkt beliebig, könnte alles bedeuten. Man fängt an zu lesen, versinkt von Seite zu Seite tiefer in der Geschichte, wird dann plötzlich von einem Genre überrascht, mit dem man wirklich nicht gerechnet hätte und muss weiterlesen und durchhalten und weiterblättern und zu Ende lesen, weil an ein Weglegen des Buches und an Schlaf gar nicht zu denken wäre.
Nicht selten bringen einen Bücher um den Schlaf, brennt die Leselampe länger als eigentlich geplant, wacht man morgens auf, ärgert sich über die kurze Nacht und freut sich dennoch gleichzeitig über das Gelesene. Und: Manche Bücher sind heimtückisch. Sie haben beispielsweise einen Autor, dessen Name allein bereits Gutes verheißt und der wegen seiner famosen Texte große Erwartungen weckt. Sie sehen ganz unscheinbar aus, der Klappentext verrät nicht allzu viel und der Titel wirkt beliebig, könnte alles bedeuten. Man fängt an zu lesen, versinkt von Seite zu Seite tiefer in der Geschichte, wird dann plötzlich von einem Genre überrascht, mit dem man wirklich nicht gerechnet hätte und muss weiterlesen und durchhalten und weiterblättern und zu Ende lesen, weil an ein Weglegen des Buches und an Schlaf gar nicht zu denken wäre. Syrien im Jahr 2012. Yasmin leitet in einer Stadt im Norden ein geheimes Krankenhaus, das „Freedom Hospital“, in dem verletzte Rebellen versorgt werden. Demonstrationen gegen das Regime sind an der Tagesordnung. Die Zuversicht, dass das Regime bald gestürzt wird, ist anfangs noch vorhanden, schwindet aber bald mehr und mehr. Panzer, Raketen und Luftangriffe zerstören nach und nach jede Normalität in der Stadt.
Syrien im Jahr 2012. Yasmin leitet in einer Stadt im Norden ein geheimes Krankenhaus, das „Freedom Hospital“, in dem verletzte Rebellen versorgt werden. Demonstrationen gegen das Regime sind an der Tagesordnung. Die Zuversicht, dass das Regime bald gestürzt wird, ist anfangs noch vorhanden, schwindet aber bald mehr und mehr. Panzer, Raketen und Luftangriffe zerstören nach und nach jede Normalität in der Stadt. Es gibt Bücher, die liest man wie im Rausch, die fesseln einen an sich und lassen nicht mehr los bis zur letzten Seite – oder noch über diese hinaus. Sie schlagen ein wie Bomben, sie beschäftigen so sehr, dass sie Gesprächsstoff werden für viele Stunden weit ausschweifender Unterhaltungen, weil sie die eigenen Gedanken so sehr umklammern und beflügeln.
Es gibt Bücher, die liest man wie im Rausch, die fesseln einen an sich und lassen nicht mehr los bis zur letzten Seite – oder noch über diese hinaus. Sie schlagen ein wie Bomben, sie beschäftigen so sehr, dass sie Gesprächsstoff werden für viele Stunden weit ausschweifender Unterhaltungen, weil sie die eigenen Gedanken so sehr umklammern und beflügeln. Ich wärme meinen neuen Zahnschutz in der Hand an. Wende ihn mit den Fingern und presse ihn etwas zusammen. So mache ich es vor jedem Kampf.
Ich wärme meinen neuen Zahnschutz in der Hand an. Wende ihn mit den Fingern und presse ihn etwas zusammen. So mache ich es vor jedem Kampf. „Bevor meine Frau zur Vegetarierin wurde, hielt ich sie in jeder Hinsicht für völlig unscheinbar.“
„Bevor meine Frau zur Vegetarierin wurde, hielt ich sie in jeder Hinsicht für völlig unscheinbar.“